|
|
weitere Märchen |
 |
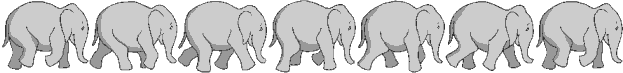
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
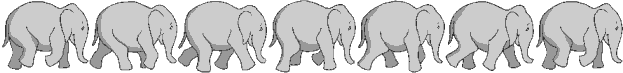
Eduard Mörike wurde am 8. September 1804 in Ludwigsburg geboren und starb am 4. Juni 1875 in Stuttgart. Er war evangelischer Pfarrer - deutscher Lyriker, Erzähler und Übersetzer.
|
|
weitere Märchen |
 |
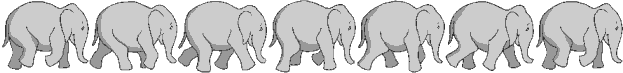
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
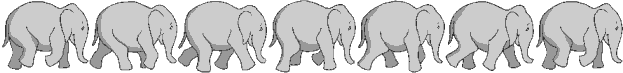
Eduard Mörike wurde am 8. September 1804 in Ludwigsburg geboren und starb am 4. Juni 1875 in Stuttgart. Er war evangelischer Pfarrer - deutscher Lyriker, Erzähler und Übersetzer.
![]()
![]()
Der Blautopf ist der große runde Kessel eines wundersamen Quells bei einer Felsenwand gleich hinter einem Kloster. Gen Morgen sendet er ein Flüsschen aus, die Blau, welche der Donau zufällt. Dieser Teich ist einwärts wie ein tiefer Trichter, sein Wasser ist von Farbe ganz blau, sehr herrlich, mit Worten nicht wohl zu beschreiben; wenn man es aber schöpft, sieht es ganz hell in dem Gefäß.
Zuunterst auf dem Grund saß ehemals eine Wasserfrau mit langen, fließenden Haaren. Ihr Leib war allenthalben wie eines schönen, natürlichen Weibes, dies eine ausgenommen, dass sie zwischen den Fingern und Zehen eine Schwimmhaut hatte, blühweiß und zarter als ein Blatt von Mohn. Im Städtlein ist noch heutzutage ein alter Bau, vormals ein Frauenkloster, hernach zu einer großen Wirtschaft eingerichtet und hieß darum der Nonnenhof. Dort hing vor sechzig Jahren noch ein Bildnis von dem Wasserweib, trotz Rauch und Alter noch wohl kenntlich in den Farben. Da hatte sie die Hände kreuzweis über die Brust gelegt, ihr Angesicht weißlich, das Haupthaar schwarz, die Augen aber, die sehr groß waren, blau. Beim Folk hieß sie die arge Lau im Topf, auch wohl die schöne Lau. Gegen die Menschen erzeigte sie sich bald böse, bald gut. Zuzeiten, wenn sie in Unmut den Gumpen übergehen ließ, kam Stadt und Kloster in Gefahr. Dann brachten ihr die Bürger in einem feierlichen Aufzug oft Geschenke, sie zu begütigen, als: Gold- und Silbergeschirr, Becher, Schalen, kleine Messser und andere Dinge, dawider zwar, als einen heidnischen Gebrauch und Götzendienst, die Mönche redlich eiferte, bis dieser auch endlich ganz abgestellt worden. So feind darum die Wasserfrau dem Kloster war, geschah es doch nicht selten, wenn Pater Emmeran die Orgel drüben schlug und kein Mensch in der Nähe war, dass sie am lichten Tag mit halbem Leib heraufkam und zuhorchte. Dabei trug sie zuweilen einen Kranz von breiten Blättern um den Kopf und dergleichen um den Hals.
Ein frecher Hirtenjunge belauschte sie einmal in dem Gebüsch und rief: „Hei, Laubfrosch! Git’s guat Wetter?“ Geschwinder als ein Blitz und giftiger als eine Otter fuhr sie heran, ergriff den Knaben beim Schopf und riss ihn mit hinunter in eine ihrer nassen Kammern, wo sie den ohnmächtig Gewordenen jämmerlich verschmachten und verfaulen lassen wollte.
Bald aber kam er wieder zu sich, fand eine Tür und kam über Stufen und Gänge durch viele Gemächer in einen schönen Saal. Hier war es lieblich, glusam mitten im Winter. In einer Ecke brannte, indem die Lau und ihre Dienerschaft schon schlief, auf einem hohen Leuchter mit goldenen Vogelfüßen als Nachtlicht eine Ampel. Es stand viel köstlicher Hausrat herum an den Wänden, und diese waren samt dem Estrich ganz mit Teppichen bedeckt, Bildweberei in allen Farben. Der Knabe nahm hurtig das Licht herunter von dem Stock, sah sich in Eile um, was er noch sonst erwischen möchte, und griff aus einem Schrank etwas heraus, das stak in einem Beutel und war mächtig schwer, deswegen er vermeinte, es sei Gold. Er lief dann und kam vor ein erzenes Pförtlein, das mochte in der Dicke gut zwei Fäuste sein, schob die Riegel zurück und stieg eine steinerne Treppe hinauf in unterschiedlichen Absätzen, bald links, bald wieder rechts, gewiss vierhundert Stufen, bis sie zuletzt ausgingen und er auf ungeräumte Klüfte stieß. Da musste er das Licht dahinten lassen und kletterte so mit Gefahr seines Lebens noch eine Stunde lang im Finsteren hin und her; dann aber brachte er den Kopf auf einmal aus der Erde. Es war tiefe Nacht und dicker Wald um ihn. Als er nach vielem Irregehen endlich mit der ersten Morgenhelle auf gängige Pfade kam und von dem Felsen aus das Städtlein unten erblickte, verlangte ihn, am Tage zu sehen, was in dem Beutel wäre. Da war es weiter nichts als ein Stück Blei, ein schwerer Kegel, spannenlang, mit einem Öhr an seinem oberen Ende, weiß vor Alter. Im Zorn warf er den Plunder weg, ins Tal hinab, und sagte nachher weiter niemandem von dem Raub, weil er sich dessen schämte. Doch kam von ihm die erste Kunde von der Wohnung der Wasserfrau unter die Leute.
![]()
![]()
Morgens beim Aufstehen sagte einmal der Peter ganz erschrocken zu seinem Weib: "Ei, schau doch, Ev', was hab' ich da für blaue Flecken! Am ganzen Leib schwarzblau! Und denkt mir doch nicht, dass ich Händel hatte!"
"Mann", sagte die Frau, "du hast gewiss wieder den Hansel, die arme Mähre, halb lahm geschlagen! Vom Ehni hab' ich das wohl öfter denn hundertmal gehört: Wenn einer sein Vieh misshandelt, sei's Stier, sei's Esel oder Pferd, da schickt es seinem Peiniger bei Nacht die blauen Mäler zu. Jetzt haben wir's deutlich!"
Der Peter aber brummte: "Hum, wenn's nichts weiter zu bedeuten hat!" schwieg still und meinte, die Flecken möchten ihm den Tod ansagen, weshalb er auch etliche Tage zahm und geschmeidig war, dass es dem ganzen Haus zugut kam. Kaum aber ist ihm die Haut wieder heil, da ist er wie immer der grimmige Peter mit seinem roten Kopf und lauter Flüchen zwischen den Zähnen. Der Hansel sonderlich hatte sehr böse Zeit, dazu noch bittern Hunger, und wenn ihm oft im Stall die Knochen alle weh taten von allzu harter Arbeit, sprach er wohl einmal vor sich hin: "Ich wollt', es holte mich ein Dieb, den würd' ich sanft wegtragen !"
Es hatte aber der Bauer einen herzguten Jungen, Frieder mit Namen, der tat dem armen Tier alle Liebe. Wenn die Stalltür aufging, etwas leiser als sonst, drehte der Hansel gleich den müden Kopf herum, zu sehen, ob es der Frieder sei, der ihm heimlich sein Morgen- oder Vesperbrot brachte. So kommt der Junge auch einmal hinein, erschrickt aber nicht wenig; denn auf des Braunen Rücken sitzt ein schöner Mädchenengel mit einem silberhellen Rock und einem Wiesenblumenkranz im gelben Haar und streicht dem Hansel die Buckel und Beulen glatt mit seiner weißen Hand. Der Engel sieht den Frieder an und spricht:"Dem wackern Hansel geht's noch gut,
wenn ihn die Königsfrau reiten tut.
Armer Frieder
wird Ziegenhüter,
kriegt aber Überfluss,
wenn er schüttelt die Nuss,
wenn er schüttelt die Nuss!"Darauf verschwand der Engel wieder und war nicht mehr da.
Den Knaben überlief’s; er huschte hurtig aus der Tür. Als er aber den Worten, die er vernommen, weiter nachsann, ward er fast traurig.
"Ach", dachte er, "der Ziegenbub vom Flecken sein, das ist doch gar ein faul und ärmlich Leben, da kann ich meiner Mutter nicht das Salz in die Suppe verdienen. Aber Nüsse? Woher? In meines Vaters Garten wachsen keine, und wenn ich sie auch ganzer Säcke voll schütteln sollte, wie der Engel verheißt, davon wird niemand satt. Ich weiß, was ich tun will, wenn ich die Ziegen hüten muss: Ich sammle Besenreisig nebenher und lerne Besen binden, da schafft sich doch ein Kreuzer."
Solche Gedanken hatte Frieder jenen ganzen Tag, sogar in der Schule, und schaute darein wie ein Träumer.
"Wieviel ist sechs mal sechs?", fragte der Schulmeister beim Einmaleins. "Nun, Frieder, was geht dir heut' im Kopf herum? Schwätz!"
Der Bub, voll Schrecken, wusste nicht, sollt' er sagen "Besenreisig" oder "sechsunddreißig", denn eigentlich war beides richtig! Er sagte aber: "Besenreisig!" Da gab es ein Gelächter, dass alle Fenster klirrten, und es blieb noch lange ein Sprichwort in der Schule, wenn einer in Gedanken saß: Der hat Besenreisig im Kopf!
In der Nacht konnte Frieder nicht schlafen. Einmal kam es ihm vor, als sei es im Hof nicht geheuer; er richtete sich auf und sah durchs Fenster über seinem Bett. Sieh, da drang eine Helle aus dem Stall und kam der Hansel heraus und der Engel auf ihm, der ritt ihn aus dem Hof so sachten Tritts, als ging' es über Baumwolle weg. Im ersten Augenblick will Frieder schreien; doch gleich besinnt er sich und denkt: "Es ist ja Hansens Glück!", legt sich also geruhig wieder hin und weint nur still in die Kissen, dass jetzt der Hansel fort sein soll und nimmer wiederkommen.
Wie nun die zwei auf offener Straße waren und der Gaul im Mondschein seinen Schatten sah, sprach er für sich: "Ach, bin ich nicht ein dürres Bein! Eine Königin säße mir nimmermehr auf!"
Der Engel sagte weiter nichts hiergegen und lenkte bald seitwärts in einen Feldweg ein, wo sie nach einer guten Strecke an eine schöne Wiese kamen. Sie war voll goldener Blumen und hieß die unsichtbare; denn sie ward von gewöhnlichen Leuten nicht gesehen und ging bei Tage immer in einen nahen Wald hinein, dass sie kein Mensch ausfand. Kam aber guter, armer Leute Kind mit einem Kühlein oder einer Geiß daher, dem zeigte der Engel die Wiese. Es wuchs ein herrliches Futter auf ihr, auch mancherlei seltsame Kräuter, davon ein Tier fast wunderbar gedieh. Auf diesem Platz stieg der Engel jetzt ab, sprach: "Weide, Hans!", lief dann am Bach hinunter und schwand in die Lüfte, nur wie ein Stern am Himmel hinzückt. Der Hansel seinerseits fraß aber tapfer zu, und als er satt war, tat's ihm leid, so fett und milchig war das zarte Gras. Endlich kommt ihm der Schlaf; also legt er sich stracks an den Hügel dort bei den runden Buchen und ruht bei vier Stunden. Plötzlich weckt ihn ein Jägerhorn; da war es Tag und stund die Sonne hell und klar am Himmel. Rasch springt er auf, sieht seinen Schatten auf dem grünen Rasen, verwundert sich und spricht: "Ei, was bin ich für ein schmucker Kerl geworden, rund, glatt und sauber!" So war es auch, und seine Haut glänzte wie in Öl gebadet.
Nun aber jagte der König des Landes schon etliche Tage in dieser Gegend und ging just aus dem Wald hervor mit seinen Leuten.
"Ah, schaut! Ah, schaut!", rief er, "was für ein schönes Ross! Wie es die stolzen Glieder übt in Sprüngen und luftigen Sätzen!" So sprechend, trat er nahe herzu mit den Herren vom Hofe; die verwunderten sich alle über das Pferd und klopften ihm liebkosend auf den Hals.
Nun sagte der König: "Reit', Jäger, in das Dorf hinein, zu fragen, ob dieses Tier nicht feil! Sag' ihnen, es käm' an keinen schlechten Herrn!" Der Jägersmann ritt eine Schecke, welche dem Hansel wohl gefiel, derhalben er von selbst mit in den Flecken trabte, wo die Bauern alsbald neugierig die Köpfe aus den Fenstern streckten.
"Hört, Leute! Wessen ist der feine Braune?", rief der Jäger durch die Gassen. "Mein ist er nicht! Das ist kein hiesiger!", hieß es von allen Seiten.
"Sieh, Frieder, guck'!", sagte der Peter, "das ist ein ungarischer! Ich wollt', der wär' mein!" Zuletzt beteuerte der Hufschmied, ein solches Tier sei auf sechs Meilen im Revier gar nicht zu Hause. Da ritt der Jäger samt dem Hansel zum König zurück, vermeldend: "Das Ross ist herrenlos!"
"Behalten wir's denn!", versetzte der König, und also ging der Zug weiter.
Indessen meint der Peter, es wäre Zeit, sein Vieh zu füttern, und stößt mit Gähnen die Stalltür auf. Hu, macht der Rüpel Augen, wie er den leeren Stand der Mähre sieht! Lange waren ihm alle Gedanken wie weggeblasen.
"Zum Kuckuck!", fuhr er endlich auf, "es wird nicht viel fehlen, so war da vorhin der fremde Gaul mein Hansel und ist's mit des Teufels Blendwerk geschehen, dass ihn kein Mensch dafür erkannte!" Der Peter wollte sich die Haare ausraufen; allein, was konnte er machen? Der Gaul war weg! Es waren nur die zwei Öchslein zu bedauern. An denen ließ der Unmensch seinen Grimm in diesen Tagen aus, und sie mussten für ihrer drei arbeiten. Was ihnen aber, nächst Püffen, Schlägen, Hungerleiden, das Leben vollends ganz verleidete, das war das Heimweh nach dem braven Hans. Sie trauerten und wurden wie verstockt und taten alles widerwillig, weshalb der Peter leis zu seinem Weibe sprach: "Es ist schon nicht anders, die Ochsen sind mir auch verhext!" Bald wurden die Eheleute eins, dass sie das Paar für ein Spottgeld dem Metzger abließen; der schlachtete sie in der Stadt. Allein was geschieht? In einer Nacht, da alles schläft, klopft es beim Peter am Laden! Er schreit: "Wer ist da drauß?" Da antworten ihm zwei tiefe Bassstimmen:"Der Walse und der Bleß
müssen wandeln deinetwegen,
wollen zu fressen, fressen in ihre kalten Mägen!"Dem Peter schauerte die Haut; er zupfte sein Weib: "Steh du auf, Ev'!"
"Ich nicht!", antwortete die Frau; "sie wollen halt ihre Sachen von dir!" So stund das Großmaul auf mit Zittern, warf ihnen Futter hinaus, und als sie damit fertig waren, gingen sie wieder.
Nun kam das Unglück Schlag auf Schlag. Der Peter brachte zwar vom nächsten Markt wieder zwei Stiere heim; allein da zeigte sich's, es wollte mit aller Liebe kein Vieh mehr in dem Stalle bleiben: Die beiden Stiere samt der Kuh wurden krank; man musste sie mit Schaden aus dem Hause tun. Der Peter läuft zu einem Hexenbanner, will sagen: zu einem Erzspitzbuben, legt ihm gutwillig einen Taler hin; dafür kriegt er ein Pulver, mit dem soll' er den Stall durchräuchern Schlag zwölfe um Mittag. Er räucherte auch wirklich so gründlich, dass er die Glut ins Stroh brachte, und es schlug der rote Hahn alsbald die Flügel auf dem Dach, das heißt: Stallung und Scheuer gingen in lichten Flammen auf. Mit knapper Not konnte die Löschmannschaft das Wohnhaus retten.
Die nächste Nacht klopft es am Kammerladen. "Wer ist da?""Der Walse und der Bleß
kommen in Wind und Regen,
wollen zu fressen, fressen in ihre kalten Mägen!"Da fuhr der Peter in Verzweiflung aus dem Bett, schlug die Hände überm Kopf zusammen und rief: "Ach mein! Ach mein! Soll ich die Toten füttern und hab' doch bald für die Lebendigen nichts mehr!"
Das erbarmte die Tiere; sie gingen fort und kamen auch nimmermehr.
Anstatt dass der Peter jetzt in sich geschlagen hätte und seinen Frevel gutgemacht, bot er dem Jammer Trutz im Wirtshaus unter lustigen Gesellen. Je mehr sein Weib ihn schalt, desto weniger schmeckte es ihm daheim; er machte dabei Schulden, und bald kam es so weit, dass man ihm Haus und Gut verkaufte. Jetzt musste er taglöhnen, und auch sein armes Weib spann fremder Leute Faden. Der Frieder aber, der saß richtig vor dem Dorf, hielt einen Stecken in der Hand und wartete der Ziegen und band Besenreis zum Verkauf.
Drei Jahre waren so vergangen, da begab sich's einmal wieder, dass der König das Wildschwein jagte, und auch die Königin war diesmal dabei. Weil es aber Winterszeit war und sehr kalt, wollten die Herrschaften das Mittagsmahl nicht gern im Freien nehmen, sondern die königlichen Köche machten ein Essen fertig im Greifenwirtshaus ; man speiste im oberen Saal vergnüglich, und die Spielleute bliesen dazu. Das Volk aber stund auf der Gasse zu horchen. Als nunmehr nach der Tafel die Pferde wieder vorgeführt wurden und man nun auch das Leibross der Königin zäumte, stand vornean der Ziegenbub, der sprach gar keck zum Reitknecht hin: "Das Ross ist meines Vaters Ross, dass Ihr's nur wisst!" Da lachte alles Volk laut auf; der Braune aber wieherte dreimal vor Freuden und strich mit seinem Kopf an Frieders Achsel auf und nieder. Dies alles sah und hörte die Königin hoch verwundert und sagte es gleich ihrem Gemahl. Der lässt den Ziegenbuben rufen, und dieser tritt bescheidentlich, doch munter in den Saal mit Backen rosenrot, und er war auch sonst ein sauberer Bursche mit lachenden Augen, ging aber barfuß.
Redet ihn der König an: "Du sagtest ja, das schöne Pferd da unten wär' deines Vaters, nicht?"
"Und ist auch wahr, Herr, mit Respekt zu melden."
"Wie willst du das beweisen, Bursch'?" "Ich will es wohl, wenn Ihr's vergönnt. Den Reitknecht hört' ich rühmen, das Ross ließe niemand aufsitzen außer der Königin, der es gehöre. Nun sollt Ihr aber sehen, ob mir's nicht stille hält und nachläuft, wenn ich ihm Hansel rufe; danach mögt Ihr denn richten, ob ich die Wahrheit sprach."
Der König schwieg ein Weilchen und sprach dann zu einem seiner Leute: "Bringt mir drei wackre Männer aus der Gemeinde her, damit wir hören, was an dem Knaben sei!" Als nun die Männer kamen und über das Pferd gefragt wurden, so fiel ihr Ausspruch nicht zu Frieders Gunsten aus. Da tät der Knabe seinen Mund selbst auf und hub an, treu und einfältig die Geschichte vom Engel zu erzählen, wie er den Hansel entführte, auch wie er ihm unlängst wieder erschienen sei und ihm die unsichtbare Wiese gezeigt habe, welche den Hansel so stattlich gemacht. Darüber waren freilich die Anwesenden hoch erstaunt; etliche blickten schelmisch; allein die Königin sagte: "Gewiss, das ist ein frommer Sohn, und die Wahrheit steht ihm an der Stirn geschrieben."
Der König selbst schien dem Buben wohlgesinnt; doch, weil er guter Laune war, sprach er: "Das Probestück wollen wir ihm nicht erlassen." Hiermit rief er den Frieder an ein Seitenfenster, das nach dem Freien ging auf einen Grasplatz, weit und flach. In dessen Mitte stand ein großer Nussbaum, wohl hundert Schritt vom Haus. Es lag aber alles dicht überschneit; denn es war im Christmond.
"Du siehst", sagte der König, "die große Wiese hier."
,0 ja, warum denn nicht!", rief ein Hofmann, des Königs Spaßmacher, halblaut dazwischen; "es ist freilich eine von den unsichtbaren; denn sie ist über und über mit Schnee zugedeckt!" Die Hofleute lachten; der König aber sprach zum Knaben: "Lass dich ein loses Maul nicht irren! Schau, du sollst mir auf dem Hansel einen Ring rund um den Nussbaum in den Schnee hier reiten, und wenn es gut abläuft, soll aller Boden innerhalb des Rings dein eigen sein!"
Da freuten sich die Schranzen, meinend, es gebe einen rechten Schnack; der Frieder aber wurde so freundlich, dass er die weißen Zähne nicht wieder unterbringen konnte. Das Ross ward vorgeführt, nachdem man ihm zuvor den goldenen Frauensattel abgenommen; es jauchzte hellauf und alles Volk mit ihm, und Frieder saß oben mit einem Schwung. Erst ritt er langsam bis zur Wiese vor, hielt an und maß mit dem Auge nach allen Seiten den Abstand vom Baum; dann setzte er den Hansel in Trab und endlich in gestreckten Lauf. Das ging wie geblasen, und es war eine Lust, ihm zuzusehen, wie sicher und leicht der Bursche saß. Er war aber nicht dumm und nahm den Kreis so weit, wie er nur konnte; gleichwohl lief dieser am Ende so schön zusammen, als wäre er mit dem Zirkel gemacht. Mit Freudengeschrei ward der Frieder empfangen; im Nu saß er ab, küsste den Hansel auf den Mund, und der König am Fenster winkt' ihm herauf in den Saal.
"Du hast", sprach er zu ihm, "dein Probestück wohl gemacht; die Wiese ist dein. Den Hansel freilich, den kann ich dir nicht wiedergeben: ich hab' ihn meiner Königin geschenkt; es soll aber dein Schade nicht sein." Mit diesen Worten drückte er ihm ein Beutelein in die Hand, gespickt voll Dublonen. Des war der Knabe sehr zufrieden, zumal die Königin hinzusetzte, er möge alle Jahre zur Stadt kommen, in ihrem Schloss vorsprechen und den Hansel besuchen.
"Ja", rief der Frieder, "und da bring' ich Euch zur Kirchweih allemal ein Säcklein grüne Nüsse vom Baum!"
"Bleib' es dabei!", sagte die Königin; so schieden sie.
Der Frieder lief heim durch all das Volksgewühl und Gejubel hindurch zu seinen Eltern. Der Peter hatte den Ritt von weitem heimlich mit angesehen, und jetzt tat er in seinem Herzen ein Gelübde - ich brauche ja wohl nicht zu sagen, worin das bestand. Genug, der Hansel und der Frieder hatten ihm wieder auf einen grünen Zweig geholfen; er wurde ein braver, ehrsamer Mann, dazu ein reicher, der einen noch reicheren Sohn hinterließ. Seit dieser Zeit hat sich im ganzen Dorf kein Mensch an einem Tier mehr versündigt.
studierte Medizin und erhielt 1863 den Professorentitel.
Er wurde 1885 von Kaiser Wilhelm I geadelt und von Papst Pius IX nach Rom berufen. Er ist Begründer der modernen wissenschaftlichen Orthopädie.
![]()
![]()
Ein junger Bauer, mit dem es in der Wirtschaft nicht recht vorwärtsgehen wollte, saß auf seinem Pfluge und ruhte einen Augenblick aus, um sich den Schweiß vom Angesichte zu wischen. Da kam eine alte Hexe vorbeigeschlichen und rief ihm zu: "Was plagst du dich und bringst's doch zu nichts? Geh zwei Tage lang geradeaus, bis du an eine große Tanne kommst, die frei im Walde steht und alle anderen Bäume überragt. Wenn du sie umschlägst, ist dein Glück gemacht."
Der Bauer ließ sich das nicht zweimal sagen, nahm sein Beil und machte sich auf den Weg. Nach zwei Tagen fand er die Tanne. Er ging sofort daran, sie zu fällen, und in dem Augenblicke, als sie umstürzte und mit Gewalt auf den Boden schlug, fiel aus ihrem höchsten Wipfel ein Nest mit zwei Eiern heraus. Die Eier rollten auf den Boden und zerbrachen, und wie sie zerbrachen, kam aus dem einen Ei ein junger Adler heraus, und aus dem andern fiel ein kleiner goldner Ring. Der Adler wuchs zusehends, bis er wohl halbe Manneshöhe hatte, schüttelte seine Flügel, als wollte er sie probieren, erhob sich etwas über die Erde und rief dann: "Du hast mich erlöst! Nimm zum Dank den Ring, der in dem andern Ei gewesen ist! Es ist ein Wunschring. Wenn du ihn am Finger umdrehst und dabei einen Wunsch aussprichst, wird er alsbald in Erfüllung gehen. Aber es ist nur ein einziger Wunsch im Ring. Ist der getan, so hat der Ring alle weitere Kraft verloren und ist nur wie ein gewöhnlicher Ring. Darum überlege dir wohl, was du dir wünschst, auf dass es dich nicht nachher gereue!"
Darauf erhob sich der Adler hoch in die Luft, schwebte lange noch in großen Kreisen über dem Haupte des Bauern und schoss dann wie ein Pfeil nach Morgen.
Der Bauer nahm den Ring, steckte ihn an den Finger und begab sich auf den Heimweg. Als es Abend war, langte er in einer Stadt an; da stand der Goldschmied im Laden und hatte viele köstliche Ringe feil. Der Bauer zeigte ihm seinen Ring und fragte ihn, was er wohl wert wäre.
"Einen Pappenstiel!" versetzte der Goldschmied. Da lachte der Bauer laut auf und erzählte ihm, dass es ein Wunschring sei und mehr wert als alle Ringe zusammen, die jener feilhielte. Doch der Goldschmied war ein falscher, ränkevoller Mann. Er lud den Bauer ein, über Nacht bei ihm zu bleiben, und sagte: "Einen Mann wie dich, mit solchem Kleinode, zu beherbergen, bringt Glück; bleibe bei mir!" Er bewirtete ihn aufs schönste mit Wein und glatten Worten, und als er nachts schlief, zog er ihm unbemerkt den Ring vom Finger und steckte ihm stattdessen einen ganz gleichen, gewöhnlichen Ring an.
Am nächsten Morgen konnte es der Goldschmied kaum erwarten, dass der Bauer aufbräche. Er weckte ihn schon in der frühesten Morgenstunde und sprach: "Du hast noch einen weiten Weg vor dir! Es ist besser, wenn du dich früh aufmachst."
Sobald der Bauer weg war, ging er eiligst in seine Stube, schloss die Läden, damit niemand etwas sähe, riegelte dann auch noch die Tür hinter sich zu, stellte sich mitten in die Stube, drehte den Ring um und rief: "Ich will gleich hunderttausend Taler haben!"
Kaum hatte er dies ausgesprochen, so fing es an, Taler zu regnen, harte, blanke Taler, als wenn es mit Mulden gösse, und die Taler schlugen ihm auf Kopf, Schultern und Arme. Er fing an, kläglich zu schreien, und wollte zur Tür springen; doch ehe er sie erreichen und aufriegeln konnte, stürzte er, am ganzen Leibe blutend, zu Boden. Aber das Talerregnen nahm kein Ende, und bald brach von der Last die Diele zusammen, und der Goldschmied mitsamt dem Gelde stürzte in den tiefen Keller. Darauf regnete es immer weiter, bis die hunderttausend voll waren, und zuletzt lag der Goldschmied tot im Keller und auf ihm das viele Geld. Von dem Lärm kamen die Nachbarn herbeigeeilt, und als sie den Goldschmied tot unter dem Gelde liegen fanden, sprachen sie: "Es ist doch ein großes Unglück, wenn der Segen so knüppeldick kommt!" Darauf kamen auch die Erben und teilten.
Unterdes ging der Bauer vergnügt nach Hause und zeigte seiner Frau den Ring. "Nun kann es uns gar nicht fehlen, liebe Frau", sagte er. "Unser Glück ist gemacht! Wir wollen uns nur recht überlegen, was wir uns wünschen wollen."
Doch die Frau wusste gleich guten Rat. "Was meinst du", sagte sie, "wenn wir uns noch etwas Acker wünschten? Wir haben gar so wenig. Da reicht so ein Zwickel gerade zwischen. unsere Äcker hinein; den wollen wir uns wünschen."
"Das wäre der Mühe wert!", erwiderte der Mann. "Wenn wir ein Jahr tüchtig arbeiten und etwas Glück haben, können wir ihn uns vielleicht kaufen." Darauf arbeiteten Mann und Frau ein Jahr lang mit aller Anstrengung, und bei der Ernte hatte es noch nie so geschüttet wie dieses Mal, so dass sie sich den Zwickel kaufen konnten und noch ein Stück Geld übrigblieb. "Siehst du", sagte der Mann, "wir haben den Zwickel, und der Wunsch ist immer noch frei!"
Da meinte die Frau, es wäre wohl gut, wenn sie sich noch eine Kuh wünschten und ein Pferd dazu.
"Frau", entgegnete abermals der Mann, indem er mit dem übriggebliebenen Gelde in der Hosentasche klapperte, "was wollen wir wegen solch einer Lumperei unsern Wunsch vergeben! Die Kuh und das Pferd kriegen wir auch so."
Und richtig, nach abermals einem Jahre waren die Kuh und das Pferd reichlich verdient. Da rieb sich der Mann vergnügt die Hände und sagte: "Wieder ein Jahr den Wunsch gespart und doch alles bekommen, was man sich wünschte! Was für ein Glück wir haben!" Doch die Frau redete ihrem Manne ernsthaft zu, endlich einmal an den Wunsch zu gehen.
"Ich kenne dich gar nicht wieder", versetzte sie ärgerlich.
"Früher hast du immer geklagt und gebarmt und dir alles mögliche gewünscht, und jetzt, wo du's haben kannst, wie du's willst, plagst und schindest du dich, bist mit allem zufrieden und lässt die schönsten Jahre vergehen. König, Kaiser, Graf, ein großer, dicker Bauer könntest zu sein, alle Truhen voll Geld haben - und kannst dich nicht entschließen, was du wählen willst!"
"Lass doch dein ewiges Drängen und Treiben!" erwiderte der Bauer. "Wir sind beide noch jung, und das Leben ist lang. Nur ein einziger Wunsch ist in dem Ringe, und der ist bald vertan. Wer weiß, was uns noch einmal zustößt, wo wir den Ring brauchen! Fehlt es uns denn an etwas? Sind wir nicht, seit wir den Ring haben, schon so heraufgekommen, dass sich alle Welt wundert? Also sei verständig! Du kannst dir ja mittlerweile immer überlegen, was wir uns wünschen könnten."
Damit hatte die Sache vorläufig ein Ende. Und es war wirklich, als wenn mit dem Ringe der volle Segen ins Haus gekommen wäre; denn Scheuern und Kammern wurden von Jahr zu Jahr voller und voller, und nach einer längeren Reihe von Jahren war aus dem kleinen, armen Bauer ein großer, dicker Bauer geworden, der den Tag über mit den Knechten schaffte und arbeitete, als wollte er die ganze Welt verdienen, nach der Vesper aber behäbig und zufrieden vor der Haustür saß und sich von den Leuten guten Abend wünschen ließ.
So verging Jahr um Jahr. Dann und wann, wenn sie ganz allein waren und niemand es hörte, erinnerte zwar die Frau ihren Mann immer noch an den Ring und machte ihm allerhand Vorschläge. Da er aber jedes Mal erwiderte, es habe noch vollauf Zeit, und das Beste falle einem stets zuletzt ein, so tat sie es immer seltener, und zuletzt kam es kaum noch vor, dass auch nur von dem Ringe gesprochen wurde. Zwar der Bauer selbst drehte den Ring täglich wohl zwanzigmal am Finger um und besah ihn sich; aber er hütete sich, einen Wunsch dabei auszusprechen.
Und dreißig und vierzig Jahre vergingen, und der Bauer und seine Frau waren alt und schneeweiß geworden, der Wunsch aber war immer noch nicht getan. Da erwies ihnen Gott eine Gnade und ließ sie beide in einer Nacht selig sterben.
Kinder und Kindeskinder standen um ihre beiden Särge und weinten, und als eins von ihnen den Ring abziehen und aufheben wollte, sagte der älteste Sohn: "Lasst den Vater seinen Ring mit ins Grab nehmen! Er hat sein Lebtag seine Heimlichkeit mit ihm gehabt. Es ist wohl ein liebes Andenken. Und die Mutter besah sich den Ring auch so oft; am Ende hat sie ihn dem Vater in ihren jungen Tagen geschenkt."
So wurde denn der alte Bauer mit dem Ringe begraben, der ein Wunschring sein sollte und keiner war und doch so viel Glück ins Haus gebracht hatte, wie ein Mensch sich nur wünschen kann. Denn es ist eine eigene Sache mit dem, was richtig und was falsch ist; und schlecht Ding in guter Hand ist immer noch sehr viel mehr wert, als gut Ding in schlechter.
![]()
![]()
Bei Apolda in Thüringen liegt die Alte-Weiber-Mühle. Sie sieht ungefähr aus wie eine große Kaffeemühle, nur dass nicht oben gedreht wird, sondern unten. Unten stehen nämlich zwei große Balken heraus, und zwei Knechte fassen sie an und drehen mit ihnen die Mühle. Oben werden die alten Weiber hineingetan: faltig und bucklig, ohne Haare und Zähne - und unten kommen sie jung wieder heraus: schmuck und rotbackig wie die Borstäpfel. Mit einmal Umdrehen ist's gemacht; knack und krach geht es, dass es einem durch Mark und Bein fährt. Wenn man dann aber die, welche herauskommen und wieder jung geworden sind, fragt, ob es nicht schrecklich weh tue, antworten sie: "Lieber gar! Wunderschön ist es! Ungefähr so, wie wenn man früh aufwacht, gut ausgeschlafen hat und die Sonne ins Zimmer scheint, und draußen singen die Vögel, und die Bäume rauschen, und man sich dann noch einmal im Bett ordentlich dehnt und reckt. Da knackt's auch zuweilen."
Sehr weit von Apolda wohnte einmal eine alte Frau; die hatte auch davon gehört. Da sie nun sehr gern jung gewesen war, entschloss sie sich eines Tages kurz und machte sich auf den Weg. Es ging zwar langsam, denn sie musste oft stehenbleiben und husten; aber mit der Zeit kam sie doch vorwärts, und endlich langte sie richtig vor der Mühle an.
"Ich möchte wieder jung werden und mich ummahlen lassen", sagte sie zu einem der Knechte, der, die Hände in den Hosentaschen, vor der Mühle auf der Bank saß und aus seiner Pfeife Ringel in die blaue Luft blies. "Du lieber Gott, was das Apolda weit ist!"
"Wie heißt Ihr denn?", fragte der Knecht gähnend.
"Die alte Mutter Klapproten!"
"Setzt Euch so lange auf die Bank, Mutter Klapproten", sagte der Knecht, ging in die Mühle, schlug ein großes Buch auf und kam mit einem langen Zettel wieder heraus.
"Ist wohl die Rechnung, mein Jüngelchen?", fragte die Alte.
"I bewahre!" erwiderte der Knecht. "Das Ummahlen kostet nichts. Aber Ihr müsst zuvor das hier unterschreiben!"
"Unterschreiben?", wiederholte die Frau. "Wohl meine arme Seele dem Teufel verschreiben? Nein, das tue ich nicht! Ich bin eine fromme Frau und hoffe, einmal in den Himmel zu kommen."
"Ist nicht so schlimm!", lachte der Knecht. "Auf dem Zettel stehen bloß alle Torheiten verzeichnet, die Ihr in Eurem ganzen Leben begangen habt, und zwar ganz genau der Reihe nach, mit Zeit und Stunde. Ehe Ihr Euch ummahlen lasst, müsst Ihr Euch verpflichten, wenn Ihr nun wieder jung geworden seid, alle die Torheiten noch einmal zu machen, und zwar ganz genau in derselben Reihenfolge, gerade so, wie's auf dem Zettel steht!"
Darauf besah er den Zettel und sagte schmunzelnd: "Freilich ein bisschen viel, Mutter Klapproten, ein bisschen viel! Vom sechzehnten bis zum sechsundzwanzigsten Lebensjahre täglich eine, sonntags zwei. Nachher wird's besser. Aber im Anfang der Vierziger, der Tausend, da kommt's noch einmal dicke! Zuletzt ist's wie gewöhnlich!"
Da seufzte die Alte und sagte: "Aber Kinder, dann lohnt es ja gar nicht, sich ummahlen zu lassen!"
"Freilich, freilich", entgegnete der Knecht, "für die meisten lohnt sich's nicht! Drum haben wir eben gute Zeit, sieben Feiertage in der Woche, und die Mühle steht immer still, zumal seit den letzten Jahren. Früher war schon das Geschäft etwas lebhafter."
"Ist es denn nicht möglich, wenigstens etwas auf dem Zettel auszustreichen?", fragte die Alte noch einmal und streichelte dem Knechte die Backen. "Bloß drei Sachen, mein Jüngelchen; alles andere will ich, wenn es denn einmal sein muss, noch einmal machen."
"Nein", antwortete der Knecht, "das ist ganz und gar unmöglich! Entweder - oder!"
"Nehmt nur Euren Zettel wieder", sagte darauf die alte Frau nach einigem Besinnen; "ich habe die Lust an Eurer dummen, alten Mühle verloren!" und machte sich wieder auf den Heimweg.
Als sie aber zu Hause ankam und die Leute sie verwundert ansahen und sagten: "Aber Mutter Klapproten, Ihr kommt ja gerade so alt wieder, wie Ihr fortgegangen seid! Es ist wohl nichts mit der Mühle?" - hustete sie und antwortete: ,,0 ja, es ist wohl etwas daran, aber ich hatte zu große Angst; und dann - was hat man denn an dem bisschen Leben? Du lieber Gott!"
![]()
![]()
Der König von Makronien, der sich schon seit einiger Zeit gerade in seinen besten Jahren befand, war soeben aufgestanden und saß unangezogen auf dem Stuhle neben dem Bett. Vor ihm stand sein Hausminister und hielt ihm die Strümpfe hin, von denen der eine ein großes Loch an der Ferse hatte. Aber obwohl er den Strumpf mit großer Sorgfalt so gedreht hatte, dass der König das Loch nicht merken sollte, und obschon der König sonst mehr auf hübsche Stiefel als auf ganze Strümpfe zu achten pflegte, war das Loch dem königlichen Scharfblicke diesmal doch nicht entgangen. Entsetzt nahm er dem Minister den Strumpf aus der Hand, fuhr mit dem Zeigefinger durch das Loch, so dass er bis zum Knöchel herausguckte, und sagte dann seufzend: "Was hilft mir's, dass ich König bin, wenn ich keine Königin habe! Was meinst du, wenn ich mir eine Frau nähme?"
"Majestät", antwortete der Minister, "das ist ein erhabener Gedanke, ein Gedanke, der gewiss auch mir ganz untertänigst aufgestiegen wäre, wenn ich nicht gefühlt hätte, dass ihn Eure Majestät jedenfalls heute selbst noch zu äußern geruhen würden!"
"Schön!", erwiderte der König. "Aber glaubst du, dass ich so leicht eine Frau finden werde, die für mich passt?"
"Pah!" sagte der Minister. "Zehn für eine!"
"Vergiss nicht, dass ich große Ansprüche stelle! Wenn mir eine Prinzessin gefallen soll, muss sie klug und schön sein! Und dann ist noch ein Punkt, auf den ich ganz besonderes Gewicht lege. Du weißt, wie gern ich Pfeffernüsse esse. In meinem ganzen Reiche ist kein einziger Mensch, der sie zu backen versteht, wenigstens richtig zu backen, nicht zu hart und nicht zu weich, sondern gerade knusprig: Sie muss durchaus Pfeffernüsse backen können!"
Als der Minister dies hörte, bekam er einen heftigen Schreck.
Doch sammelte er sich rasch wieder und entgegnete: "Ein König wie Eure Majestät werden ohne Zweifel auch eine Prinzessin finden, die Pfeffernüsse zu backen versteht."
"Nun, dann wollen wir uns zusammen umsehen!" versetzte der König, und noch an demselben Tage begann er in Begleitung des Ministers die Rundreise zu denjenigen seiner verschiedenen Nachbarn, von denen er wusste, dass sie Prinzessinnen zu vergeben hatten. Aber es fanden sich nur drei Prinzessinnen, die gleichzeitig so schön und klug waren, dass sie dem König gefielen, und von diesen konnte keine Pfeffernüsse backen.
"Pfeffernüsse kann ich freilich nicht backen", sagte die erste Prinzessin, als der König sie danach fragte, "aber hübsche, kleine Mandelkuchen. Bist du damit nicht zufrieden?"
"Nein", erwiderte der König, "es müssen durchaus Pfeffernüsse sein!"
Die zweite Prinzessin, als er die nämliche Frage an sie richtete, schnalzte mit der Zunge und sagte ärgerlich: "Lasst mich mit Euren Albernheiten zufrieden! Prinzessinnen, welche Pfeffernüsse backen können, gibt es nicht!"
Am schlimmsten ging es aber dem König bei der dritten, obwohl sie die schönste und klügste war. Denn sie ließ ihn gar nicht bis zu seiner Frage kommen, sondern ehe er sie noch hatte tun können, fragte sie selbst, ob er wohl auch das Brummeisen zu spielen verstünde. Und als er dies verneinte, gab sie ihm einen Korb und meinte, es tue ihr herzlich leid. Er gefalle ihr sonst ganz gut; aber sie höre das Brummeisen für ihr Leben gern und habe sich vorgenommen, keinen Mann zu nehmen, der es nicht spielen könne.
Da fuhr der König mit dem Minister wieder nach Haus, und als er aus dem Wagen stieg, sagte er recht niedergeschlagen: "Das wäre also nichts gewesen!"
Aber ein König muss durchaus eine Königin haben, und nach längerer Zeit ließ er daher den Minister noch einmal zu sich kommen und eröffnete ihm, er habe es aufgegeben, eine Frau zu finden, die Pfeffernüsse backen könne, und beschlossen, die Prinzessin zu heiraten, welche sie damals zuerst besucht hätten. "Es ist die, welche die kleinen Mandelkuchen zu backen versteht", fügte er hinzu. "Geh hin und frage, ob sie meine Frau werden will!"
Am nächsten Tage kam der Minister zurück und erzählte, dass die Prinzessin nicht mehr zu haben sei. Sie hätte den König aus dem Lande, wo die Kapern wachsen, geheiratet.
"Nun, dann geh zur zweiten Prinzessin!" Allein der Minister kam auch dieses Mal wieder unverrichteterdinge nach Hause: Der alte König habe gesagt, er bedaure unendlich, aber seine Tochter sei leider gestorben, und so könne er sie ihm nicht geben.
Da besann sich der König lange; weil er aber durchaus eine Königin haben wollte, so befahl er dem Minister, er solle doch auch noch einmal zur dritten Prinzessin gehen, vielleicht habe sie sich inzwischen anders besonnen. Und der Minister musste gehorchen, obgleich er sehr wenig Lust verspürte und obschon ihm auch seine Frau sagte, dass es gewiss recht unnütz wäre. Der König aber wartete ängstlich auf seine Rückkunft; denn er gedachte der Frage wegen des Brummeisens, und die Erinnerung daran war ihm ärgerlich.
Die dritte Prinzessin jedoch empfing den Minister sehr freundlich und sagte zu ihm, eigentlich habe sie sich ganz bestimmt vorgenommen, nur einen Mann zu nehmen, der das Brummeisen zu spielen verstünde. Aber Träume sind Schäume, und besonders Jugendträume! Sie sehe ein, dass sich ihr Wunsch nicht erfüllen lasse, und da der König ihr sonst sehr gut gefalle, so wolle sie ihn schon zum Manne nehmen.
Da fuhr der Minister zurück, was die Pferde jagen wollten, und der König umarmte ihn und gab ihm den großen Schranzenorden mit Brettern. Bunte Fahnen wurden in der Stadt ausgehängt, Girlanden von einem Haus zum andern quer über die Straßen gezogen, und die Hochzeit wurde so herrlich gefeiert, dass die Leute vierzehn Tage von weiter nichts sprachen.
Der König und die junge Königin aber lebten in Lust und Freude ein ganzes Jahr lang. Der König hatte die Pfeffernüsse und die Königin das Brummeisen gänzlich vergessen.
Eines Tages jedoch stand der König früh mit dem falschen Bein zuerst aus dem Bette auf, und alles ging verkehrt. Es regnete den ganzen Tag; der Reichsapfel fiel hin, und das kleine Kreuz, das oben darauf ist, brach ab; dann kam der Hofmaler und brachte die neue Karte vom Königreiche, und als der König sie besah, war das Land rot angestrichen statt blau, wie er befohlen; und endlich, die Königin hatte Kopfschmerzen.
Da geschah es, dass das Ehepaar sich zum ersten Male zankte; warum, wussten sie am andern Morgen selbst nicht mehr, oder wenn sie es wussten, wollten sie es wenigstens nicht sagen. Kurz, der König war brummig und die Königin schnippisch und behielt stets das letzte Wort. Nachdem sie sich beide lange Zeit hin und her gestritten, zuckte die Königin endlich verächtlich mit den Achseln und sagte: "Ich dächte, du wärest nun endlich still und hörtest auf, alles zu tadeln, was dir vor die Augen kommt! Du selbst kannst ja nicht einmal das Brummeisen spielen!"
Aber kaum war ihr dies noch entschlüpft, als der König ihr schon ins Wort fiel und giftig antwortete: "Und du kannst nicht einmal Pfeffernüsse backen!"
Da blieb die Königin zum ersten Male die Antwort schuldig und wurde ganz still, und beide gingen, ohne weiter ein Wort zu wechseln, auseinander, jedes in seine Stube. Hier setzte sich die Königin in die Sofaecke und weinte und dachte: "Was du doch für eine törichte Frau bist! Wo hast du nur deinen Verstand gehabt? Dümmer hättest du es gar nicht anfangen können!"
Der König aber ging in seinem Zimmer auf und ab, rieb sich die Hände und sagte: "Es ist doch ein wahres Glück, dass meine Frau keine Pfeffernüsse backen kann! Was hätte ich ihr sonst erwidern sollten, als sie mir vorwarf, dass ich das Brummeisen nicht zu spielen verstünde?"
Nachdem er dies wenigstens drei- oder viermal wiederholt hatte, wurde er immer vergnügter. Er fing an, seine Lieblingsmelodie zu pfeifen, besah sich dann das große Bild der Königin, welches in seinem Zimmer hing, stieg auf einen Stuhl, um mit dem Taschentuch einen Spinnenfaden abzuwischen, der der Königin gerade über die Nase herabhing, und sagte endlich: "Sie hat sich gewiss recht geärgert, die gute, kleine Frau! Ich werde einmal sehen, was sie macht!"
Damit ging er zur Tür hinaus auf den langen Gang, auf welchen alle Zimmer mündeten. Weil aber an diesem Tage alles verkehrt ging, so hatte der Kammerdiener vergessen die Lampen anzuzünden, obgleich es schon acht Uhr abends und stockdunkel war.
Daher streckte der König die Hände vor sich hin, um sich nicht zu stoßen, und tappte vorsichtig an der Wand hin. Plötzlich fühlte er etwas Weiches.
"Wer ist da?", fragte er.
"Ich bin es", antwortete die Königin. "Was suchst du, mein Schatz?"
"Ich wollte dich um Verzeihung bitten", erwiderte die Königin, "weil ich dich so gekränkt habe."
"Das brauchst du gar nicht!", sagte der König und fiel ihr um den Hals. "Ich habe mehr Schuld als du und habe längst alles vergessen. Aber weißt du, zwei Worte wollen wir in unserm Königreiche bei Todesstrafe verbieten lassen: Brummeisen und -"
"Und Pfeffernüsse!", fiel die Königin lachend ein, indem sie sich heimlich noch ein paar Tränen aus den Augen wischte und damit hat die Geschichte ein Ende.
![]()
![]()
Vor dem Tor, gleich an der Wiese, stand ein Haus, darin wohnten zwei Leute, die hatten nur ein einziges Kind, ein ganz kleines Mädchen. Das nannten sie Goldtöchterchen. Es war ein liebes, munteres, kleines Ding, flink wie ein Wiesel. Eines Morgens geht die Mutter früh in die Küche, Milch zu holen; da steigt das Ding aus dem Bett und stellt sich im Hemdchen in die Haustür. Nun war ein wunderherrlicher Sommermorgen, und wie es so in der Haustür steht, denkt es: "Vielleicht regnet's morgen; da ist's besser, du gehst heute spazieren!" Wie's so denkt, geht's auch schon, läuft hinters Haus auf die Wiese und von der Wiese bis an den Busch. Wie's an den Busch kommt, wackeln die Haselbüsche ganz ernsthaft mit den Zweigen und rufen:
"Nacktfrosch im Hemde,
Was willst du in der Fremde?
Hast kein' Schuh und hast kein' Hos,
Hast ein einzig Strümpfel bloß;
Wirst du noch den Strumpf verlieren,
musst du dir ein Bein erfrieren.
Geh nur wieder heime;
Mach' dich auf die Beine!"Aber es hört nicht, sondern läuft in den Busch, und wie es durch den Busch ist, kommt es an den Teich. Da steht die Ente am Ufer mit einer vollen Mandel Junger, alle goldgelb wie die Eidotter, und fängt entsetzlich an zu schnattern; dann läuft sie Goldtöchterchen entgegen, sperrt den Schnabel weit auf und tut, als wenn sie es fressen wollte. Aber Goldtöchterchen fürchtet sich nicht, geht gerade darauf los und sagt:
"Ente, du Schnatterlieschen,
Halt doch den Schnabel,
und schweig ein bisschen!""Ach", sagt die Ente, "du bist's, Goldtöchterchen ! Ich hatte dich ja gar nicht erkannt; nimm's nur nicht übel! Nein, du tust uns nichts! Wie geht es dir denn? Wie geht es denn deinem Herrn Vater und deiner Frau Mutter? Das ist ja recht schön, dass du uns einmal besuchst! Das ist ja eine große Ehre für uns! Da bist du wohl recht früh aufgestanden? Also, du willst dir wohl auch einmal unsern Teich besehen? Eine recht schöne Gegend! Nicht wahr, Goldtöchterchen.“
Wie sie ausgeschnattert hat, fragt Goldtöchterchen : "Sag' einmal, Ente, wo hast du denn die vielen kleinen Kanarienvögel her?"
"Kanarienvögel?" wiederholt die Ente. "Ich bitte dich, es sind ja bloß meine Jungen!"
"Aber sie singen ja so fein und haben keine Federn, sondern bloß Haare! Was bekommen denn deine kleinen Kanarienvögel zu essen?"
"Die trinken klares Wasser und essen feinen Sand."
"Davon können sie ja aber unmöglich wachsen!"
"Doch, doch", sagt die Ente; "der liebe Gott segnet's ihnen; und dann ist auch zuweilen im Sand ein Würzelchen und im Wasser ein Wurm oder eine Schnecke."
"Habt ihr denn keine Brücke?", fragt dann weiter Goldtöchterchen.
"Nein", sagt die Ente, "eine Brücke haben wir nun allerdings leider nicht. Wenn du aber über den Teich willst, will ich dich gern hinüberfahren."
Darauf geht die Ente ins Wasser, bricht ein großes Wasserrosenblatt ab, setzt Goldtöchterchen darauf, nimmt den langen Stängel in den Schnabel und fährt Goldtöchterchen hinüber. Und die kleinen Entchen schwimmen munter nebenher.
"Schönen Dank, Ente!", sagt Goldtöchterchen, als es drüben angekommen ist.
"Keine Ursache", sagt die Ente. "Wenn du mich mal wieder brauchst, steh' ich gern zu Diensten. Empfiehl mich deinen Eltern! Schön Adje!"
Auf der anderen Seite des Teiches ist wieder eine große grüne Wiese, auf der geht Goldtöchterchen weiter spazieren. Nicht lange, so sieht es einen Storch, auf den läuft's gerade zu.
"Guten Morgen, Storch", sagt's; "was isst du denn, was so grünscheckig aussieht und dabei quakt?"
"Zappelsalat", antwortet der Storch, "Zappelsalat, Goldtöchterchen!"
"Gib mir auch was, ich bin hungrig!"
"Zappelsalat ist nichts für dich", sagt der Storch, geht an den Bach, taucht mit seinem langen Schnabel tief unter und holt erst einen goldenen Becher mit Milch und dann eine Wecke heraus. Darauf hebt er den einen Flügel und lässt eine Zuckertüte herunterfallen. Goldtöchterchen lässt sich's nicht zweimal sagen, sondern setzt sich hin und isst und trinkt.
Wie's satt ist, sagt's:
„Einen schönen Dank,
und gute Gesundheit dein Leben lang!“
Darauf läuft's weiter. Nicht lange, so kommt ein kleiner blauer Schmetterling geflogen.
"Kleines Blaues", sagt Goldtöchterchen, "wollen wir uns ein wenig haschen?"
"Ich bin's zufrieden", antwortet der Schmetterling, "aber du darfst mich nicht angreifen, damit nichts abgeht."
Nun haschen sie sich lustig auf der Wiese herum, bis es Abend wird. Wie es anfängt zu dämmern, setzt sich Goldtöchterchen hin und denkt: "Jetzt willst du dich ausruhen; dann gehst du nach Hause!" Wie's so sitzt, merkt's, dass die Blumen im Grase auch schon alle müde sind und einschlafen wollen. Das Gänseblümchen nickt ganz schläfrig mit dem Kopfe, richtet sich dann auf, sieht sich mit gläsernen Augen um, und dann nickt's noch einmal. Da steht eine weiße Aster daneben - und das war jedenfalls die Mutter - und sagt:"Gänseblümchen, mein Engelchen,
fall nicht vom Stengelchen!
Geh zu Bett, mein Kind!"Und das Gänseblümchen duckt sich hin und schläft ein. Dabei verschiebt sich's das weiße Mützchen, dass ihm die Spitzen gerade übers Gesicht fallen. Darauf schläft die Aster auch ein.
Wie Goldtöchterchen sieht, dass alles schläft, fallen ihm die Augen auch zu. Da liegt es nun auf der Wiese und schläft, und mittlerweile läuft seine Mutter immer noch im ganzen Hause umher und sucht's und weint. Sie geht in alle Kammern und sieht in alle Winkel, unter alle Betten und unter die Treppe. Dann geht sie auf die Wiese bis an den Busch und durch den Busch bis an den Teich.
"Über den Teich kann es nicht gekommen sein", denkt sie und geht wieder zurück und durchsucht noch einmal alle Winkel und Ecken und sieht unter alle Betten und unter die Treppe. Wie sie damit fertig ist, geht sie wieder auf die Wiese, und wieder in den Busch, und wieder bis an den Teich. Das tut sie den ganzen Tag, und je länger sie es tut, desto mehr weint sie. Der Mann aber läuft unterdes in der ganzen Stadt umher und fragt, ob niemand Goldtöchterchen gesehen hat.
Als es aber ganz dunkel geworden war, kam einer von den zwölf Engeln, die jeden Abend über die ganze Welt hinausfliegen müssen, um nachzusehen, ob sich nicht irgendwo ein kleines Kind verlaufen hat, und es wieder zu seiner Mutter zu bringen, und er kam auch auf die grüne Wiese. Als er Goldtöchterchen hier liegen und schlafen sah, hob er es behutsam auf, ohne es zu wecken, flog bis über die Stadt und sah nach,
in welchem Hause noch Licht war.
"Das wird wohl das Haus sein, wo's hingehört", sagte er, als er das Haus von Goldtöchterchens Eltern sah, und das Licht im Wohnzimmer brannte immer noch. Heimlich sah er zum Fenster hinein: Da saßen Vater und Mutter sich an dem kleinen Tische gegenüber und weinten, und unter dem Tische hielten sie sich die Hände. Da öffnete er ganz leise die Haustür, legte das Kind unter die Treppe und flog fort.
Und die Eltern saßen immer noch am Tisch. Da stand die Frau auf, zündete ein Licht an und leuchtete noch einmal in alle Winkel und Ecken und unter die Betten.
"Frau", sagte der Mann traurig, "du hast ja schon so oft vergeblich in alle Winkel und Ecken und unter die Treppe gesehen. Geh zu Bett! Unser Goldtöchterchen wird wohl in den Teich gefallen und ertrunken sein!"
Doch die Frau hörte nicht, sondern ging weiter, und wie sie unter die Treppe leuchtete, lag das Kind da und schlief. Da schrie sie vor Freude so laut auf, dass der Mann eilends die Treppe herabgesprungen kam. Mit dem Kinde auf dem Arm kam sie ihm freudestrahlend entgegen. Es schlief ganz fest, so müde hatte es sich gelaufen.
"Wo war es denn? Wo war es denn?", rief er.
"Unter der Treppe lag's und schlief", erwiderte die Frau, "und ich habe doch heute schon so oft unter die Treppe gesehen!"
Da schüttelte der Mann mit dem Kopfe und sagte: "Mit rechten Dingen geht's nicht zu, Mutter; wir wollen nur Gott danken, dass wir unser Goldtöchterchen wiederhaben!"
![]()
![]()
In einer kleinen Stadt lebte einmal ein junger Mann, dem alles zum Unglück ausschlug, was er anfing. Sein Vater hatte Pechvogel geheißen, und so hieß er denn auch Pechvogel. Beide Eltern waren ihm früh gestorben, und die lange, dürre Tante, die ihn damals zu sich genommen hatte, prügelte ihn jedes Mal, wenn sie aus der Messe kam. Da sie nun aber jeden Tag in die Messe ging, so prügelte sie ihn eben auch alle Tage. Er hatte aber auch wirklich sehr viel Unglück. Denn wenn er ein Glas trug, fiel es ihm gewöhnlich hin; und wenn er dann weinend die Scherben auflas, schnitt er sich stets in die Finger.
So ging es in allen Dingen. Da bemächtigte sich seiner eine große Traurigkeit, und als die lange Tante gestorben war, beschloss er, in die weite Welt zu gehen. "Schlechter kann's nimmer werden", dachte er; "vielleicht wird's besser." Er steckte daher seine ganze Barschaft in die Tasche und wanderte zum Tor hinaus.
Vor dem Tor, auf der steinernen Brücke, blieb er noch einmal stehen und lehnte sich über das Geländer. Er sah in die Wellen hinab, die reißend an den Pfeilern vorbeischäumten, und es wurde ihm gar wehmütig ums Herz. Es war ihm fast, als wenn es ein Unrecht wäre, die Stadt, in der er so lange gelebt, zu verlassen. Und vielleicht hätte er noch lange so gestanden, wenn ihm nicht plötzlich der Wind den Hut vom Kopfe geweht und in den Fluss geworfen hätte. Da erwachte er aus seinen Träumen; aber der Hut war schon unter der Brücke fortgeschwommen und tanzte auf der andern Seite mitten im Strom, und jedes Mal, wenn ihn eine Welle emporhob, schien er höhnisch zurückzurufen: "Leb' wohl, Pechvogel! Ich reise; bleibe du zu Hause, wenn du Lust hast!"
So machte sich denn Pechvogel ohne Hut auf den Weg.
Lustige Gesellen zogen oft genug singend und jubilierend an ihm vorüber und luden ihn ein, in Gemeinschaft mit ihnen die Wanderschaft fortzusetzen. Doch er schüttelte jedes Mal traurig den Kopf und sagte: "Ich passe nicht zu euch und würde euch nicht viel Glück bringen! Außerdem heiße ich Pechvogel." Sobald sie diesen Namen hörten, wurden die lustigen Burschen ernsthaft und verlegen und machten sich eiligst aus dem Staube. Erreichte er abends müde ein Wirtshaus und saß er an einer einsamen Ecke des Schenktisches, den Kopf auf die Hände gestützt und vor sich den zinnernen Krug mit Wein, der nimmer leer werden wollte, so trat wohl zuweilen das Wirtstöchterlein leise zu ihm heran, tippte ihn auf die Schulter, dass er sich erschrocken umdrehte, und fragte, warum er so traurig sei. Wenn er aber dann seine Geschichte erzählte und gar seinen Namen nannte, schüttelte sie den Kopf, ging zu ihrem Spinnrad zurück und ließ ihn allein sitzen und seinen Gedanken nachhängen.
Nachdem Pechvogel mehrere Wochen lang gewandert war, ohne recht eigentlich zu wissen, wohin, kam er eines Tages an einen wundervollen, großen Garten, der von einem hohen, vergoldeten Geländer umgeben war. Durch das Geländer hindurch sah man uralte Bäume und niedriges Buschwerk, abwechselnd mit großen Rasenplätzen. Dazwischen schlängelte sich ein Bach, über den eine Menge kleiner Brücken führten. Zahme Hirsche und Rehe spazierten auf den gelben Sandwegen umher, kamen bis ans Gitter, steckten ihre Köpfe heraus und fraßen ihm das Brot aus der Hand. In der Mitte des Gartens aber sah man aus den Bäumen ein stattliches Schloss hervorragen. Die silbernen Dächer blitzten in der Sonne, und von den Türmen wehten bunte Fahnen und Banner. Er ging das Geländer entlang; endlich fand er ein großes, offenstehendes Tor, von dem eine lange, schattige Allee gerade auf das Schloss zu führte. Im Garten selbst war alles still; kein Mensch ließ sich sehen oder hören. Am Tor hing eine Tafel. "Aha", dachte er, "wie gewöhnlich! Wenn man an einem recht schönen Garten vorbeikommt, wo die Tore einladend offen stehen, dann hängt immer eine Tafel daneben, worauf steht, dass der Eintritt verboten ist." Zu seiner großen Überraschung sah er jedoch, dass er sich diesmal täuschte; denn auf der Tafel stand weiter nichts als: "Hier darf nicht geweint werden!"
"So, so", sagte er, "eine närrische Inschrift!", zog das Taschentuch heraus und rieb sich ein wenig die Augen; denn er war nicht ganz sicher, ob nicht in einer Ecke irgendwo doch eine halbe Träne sitzengeblieben sei. Darauf trat er in den Garten ein.
Der große, breite Weg, der schnurstracks aufs Schloss zulief, machte ihn beklommen. Er schlug lieber einen Seitengang mitten zwischen hohen Jasmin- und Rosenhecken ein. Den verfolgte er und gelangte in einen kleinen Wald, aus dem ein Weg mit vielen Windungen zu einem Hügel hinaufführte. Als er jetzt abermals um eine Ecke bog, lag die Spitze des Hügels vor ihm, und auf dem Hügel im Grase saß ein wunderschönes Mädchen.
Sie hatte eine goldene Krone auf dem Schoß, auf die sie fortwährend hauchte. Dann nahm sie ihre seidene Schürze, rieb die Krone mit ihr, und als sie sah, dass sie wieder ganz blank wurde, klatschte sie vor Freude in die Hände, strich sich ihre langen Haare hinter die Ohren und setzte sich die Krone wieder auf.Den armen Pechvogel überfiel bei ihrem Anblicke eine sonderbare Angst. Sein Herz klopfte so laut, als wenn es zerspringen wollte. Er trat hinter einen Busch und duckte sich nieder. Aber es war eine Berberitze, und ein Zweig legte sich ihm gerade quer übers Gesicht. Und wie der Wind den Busch leise hin und her bewegte, kitzelte ihm ein Dorn fortwährend an der Nasenspitze herum, so dass er laut niesen musste. Erschrocken drehte sich das Mädchen mit der Krone um und sah Pechvogel hinter dem Busche kauern.
"Warum versteckst du dich?", rief sie. "Willst du mir etwas Böses tun, oder fürchtest du dich vor mir?"
Da trat Pechvogel zitternd wie Espenlaub hinter dem Busche hervor.
"Du tust mir nichts!", sagte sie lachend. "Komm her, setze dich ein wenig zu mir; meine Gespielinnen sind alle weggelaufen und haben mich allein gelassen. Du kannst mir etwas recht Hübsches erzählen, aber etwas zum Lachen! Hörst du? Aber du siehst ja so traurig aus! Was fehlt dir denn? Wenn du kein so finsteres Gesicht machtest, wärest du wirklich ein ganz hübscher Mensch."
"Wenn du es haben willst", antwortete Pechvogel, "will ich mich wohl einen Augenblick zu dir setzen. Aber wer bist du denn? Ich habe ja mein Lebtag noch nie etwas so Schönes und Herrliches gesehen wie dich!"
"Ich bin die Prinzessin Glückskind, und dies ist meines Vaters Garten."
"Was machst du denn hier so allein?"
"Ich füttere meine Rehe und Hirsche und putze meine Krone."
"Und nachher?"
"Dann füttere ich meine Goldfische!"
"Und wenn du damit fertig bist?"
"Dann kommen meine Gespielinnen wieder, und dann lachen wir und singen und tanzen!"
"Ach, was du für ein glückseliges Leben führst! Und das geht so alle Tage?"
"Ja, alle Tage! Nun sage aber auch einmal, wer du bist und wie du heißt!"
"Ach, allerschönste Prinzessin, verlangt nur das nicht von mir! Ich bin der allerunglücklichste Mensch unter der Sonne und habe den allerhässlichsten Namen."
"Pfui!" sagte sie, "ein hässlicher Name ist sehr hässlich!
In meines Vaters Ländern gibt es einen, der heißt Entengrütze, und einen andern, der heißt Fettfleck; du wirst doch nicht etwa so heißen?"
"Nein", antwortete er, "Entengrütze heiße ich nicht, auch nicht Fettfleck. Mein Name ist noch viel hässlicher. Ich heiße Pechvogel. "
"Pechvogel? Das ist ja zum Totlachen! Kannst du denn keinen anderen Namen kriegen? Höre, ich will mir einmal einen recht hübschen Namen für dich ausdenken, und dann will ich meinen Vater bitten, dass er dir erlaubt, ihn zu tragen. Mein Vater kann alles, was er will; denn er ist König. Aber nur unter der Bedingung tu' ich es, dass du ein ganz vergnügtes Gesicht machst. Nimm doch die Hand vom Gesicht; du musst dir nicht immer so an der Nase herumzupfen! Du hast eine ganz hübsche Nase und wirst sie dir noch ganz und gar verderben. Streich dir einmal die Haare aus der Stirn! So! Nun siehst du doch einigermaßen vernünftig aus! Sage einmal, warum bist du eigentlich so traurig? Denn ich bin immer vergnügt, und jeder, mit dem ich rede, freut sich. Nur dir sieht man's gar nicht an!"
"Warum ich so traurig bin? Weil ich mein ganzes Leben traurig war und stets Unglück habe. Und du bist immer lustig? Wie fängst du das an?" .
"Mich hat eine Fee über die heilige Taufe gehalten, der hatte mein Vater früher einmal einen großen Dienst erwiesen. Sie nahm mich auf den Arm, küsste mich auf die Stirn und sagte zu mir: "Du sollst immerdar fröhlich sein und alle Welt fröhlich machen! Wenn dich ein recht trauriger Mensch ansieht, soll er sein Unglück vergessen! Glückskind sollst du heißen! - Dich aber hat wohl keine Fee geküsst?"
"Nein, nein!", antwortete er, "niemals!"
Darauf wurde die Prinzessin sehr still und nachdenklich und sah ihn mit ihren großen, blauen Augen so sonderbar an, dass es ihm eiskalt den Rücken hinunterlief. Dann hub sie wieder an: "Ob es wohl immer eine Fee sein muss? Eine Prinzessin ist auch etwas! Komm her, knie dich einmal hin; denn du bist mir zu groß!"
Darauf trat sie vor ihn hin, gab ihm einen Kuss und lief lachend weg. Ehe Pechvogel sich noch recht besinnen konnte, war sie verschwunden. Langsam stand er auf. Es war ihm, als wenn er aus einem Traume erwachte, und doch fühlte er, dass es kein Traum sein könne; denn eine wunderbare Fröhlichkeit war über sein Herz gekommen.
"Wenn ich nur meinen Hut hätte", sagte er, "dass ich ihn in die Luft werfen könnte! Vielleicht finge er an zu trillern und flöge als Lerche davon! Zumut ist mir's so! Ich glaube wirklich, ich bin lustig! Das wäre doch zu merkwürdig!" - Er pflückte sich noch einen großen Blumenstrauß im Garten und wanderte singend die Landstraße weiter.
Sobald er in die nächste Stadt kam, kaufte er sich ein rotsamtenes Wams mit Atlasschlitzen und ein Barett mit einer langen, weißen Feder, besah sich im Spiegel und sagte: "Pechvogel heiße ich? Wir wollen doch sehen, ob ich nicht einen andern Namen bekomme! Aber den schönsten, den es gibt, sonst nehm' ich ihn nicht!" Dann stieg er auf ein Pferd, gab ihm die Sporen, dass es lustig dahintanzte, und setzte seine Reise fort.
Prinzessin Glückskind aber, nachdem sie dem Pechvogel den Kuss gegeben hatte, lief und lief. Dann ging sie langsamer und langsamer, und zuletzt setzte sie sich auf eine Bank unweit des Schlosses und fing an, bitterlich zu weinen.
Als ihre Gespielinnen zurückkehrten und sie fanden, weinte sie immer noch. Sie versuchten sie zu trösten, aber es half nichts. Da liefen sie in ihrer Angst zum König und riefen: "Um Gottes willen, Herr König! Ein Unglück für das ganze Land! Prinzessin Glückskind sitzt im Garten und weint, und niemand kann ihr helfen!"
Als dies der König hörte, wurde er vor Schrecken blass und sprang eilig die Treppen in den Garten hinunter. Da saß die Prinzessin weinend auf der Bank und hatte die Krone auf dem Schoß, und es waren auf sie so viele Tränen gefallen, dass sie in der Sonne blitzte, als wenn sie mit tausend Diamanten besetzt wäre. Der König nahm seine Tochter in den Arm und tröstete sie und redete ihr zu; aber sie weinte immerfort. Er führte sie in das Schloss und ließ ihr aus dem ganzen Lande alles kommen, was es nur Schönes und Kostbares gab; doch sie blieb traurig, und sooft er sie auch bat, ihm doch zu sagen, welch ein schweres Herzeleid ihr widerfahren sei, sie antwortete nicht. Aber der König fragte immer wieder, und zuletzt musste sie es sagen, und sie erzählte, wie sie im Garten gesessen und wie ein junger Mensch gekommen wäre, der so überaus traurig ausgesehen, und wie sie ihn geküsst hätte, um zu sehen, ob er dadurch nicht vielleicht etwas fröhlicher würde.
Da schlug der König die Hände über dem Kopf zusammen.
"Einen fremden, hergelaufenen Menschen, wahrscheinlich einen ganz gewöhnlichen Handwerksburschen! Mit schlechten Kleidern, und noch dazu ohne Hut! Es ist unglaublich!"
"Er dauerte mich so sehr!"
"Ein hübscher Grund für eine Prinzessin, den ersten besten Strolch zu küssen! Und Pechvogel heißt er? Unerhört! Aber den Menschen muss ich haben, und wenn ich ihn habe, wird er geköpft! Das ist die allergeringste Strafe, die ihn treffen kann!"
Darauf befahl der König seinen Reitern, das Land nach allen Richtungen hin zu durchstreifen und auf den armen Pechvogel zu fahnden.
"Wenn ihr einen jungen Menschen findet, der aussieht, als hätten ihm die Mäuse das Brot weggefressen, und der keinen Hut hat, der ist's! Den bringt ihr sofort hierher!" Und die Reiter stoben auseinander wie Spreu, in die der Wind fährt, und durchzogen das ganze Land. Manche von ihnen kamen auch an Pechvogel vorbei, der in seiner vornehmen Kleidung stolz auf dem Pferde saß, aber sie erkannten ihn nicht; und die meisten von ihnen kehrten unverrichteterdinge in das Schloss zurück, wo sie der König zornig anfuhr und alberne, ungeschickte Menschen schalt, die zu gar nichts zu gebrauchen seien. Die Prinzessin aber blieb traurig wie zuvor und kam jeden Mittag mit verweinten Augen zu Tisch, und der König tat auch weiter nichts, als dass er immer wieder seine schöne, traurige Tochter ansah, und ließ darüber Suppe und Braten kalt werden.
So ging es Woche um Woche. Eines Tages jedoch entstand plötzlich ein Lärmen auf dem Schlosshofe. Alles lief zusammen, und ehe noch der König Zeit gehabt, ans Fenster zu treten, um nach der Ursache zu sehen, führten schon zwei Reiter den armen Pechvogel in sein Zimmer. Sie hatten ihm die Hände auf dem Rücken zusammengebunden; aber sein Gesicht strahlte, als wenn ihm in seinem Leben noch nie etwas Lieberes widerfahren wäre. Er verneigte sich vor dem Könige und richtete sich dann stolz auf, abwartend, was er über ihn beschließen würde.
"Wir haben den sauberen Vogel gefangen, Majestät!" sagte der ältere der bei den Reiter. "Er muss sich aber inzwischen gemausert haben; denn Eure Beschreibung passt wie die Faust aufs Auge! Gewiss hätten wir ihn auch nie gefunden, wenn uns nicht der dumme Tölpel, als wir im Wirtshaus mit ihm zusammentrafen, die ganze Geschichte selbst erzählt hätte. Und wisst Ihr, was er getan hat, nachdem wir ihn gefangen und gebunden? Weiter gelacht und weiter gesungen! Und wie wir ihn auf sein Pferd gesetzt, zwischen unsere Pferde genommen und hierher gejagt? Geschimpft und gezankt, dass wir so langsam ritten! Als wenn er es nicht erwarten könnte, dass er geköpft wird! Wenn das der traurigste Mensch in der ganzen Christenheit sein soll, Majestät, so möchte ich wohl den allerlustigsten sehen! Der muss sich dann zum Frühstück die Beine ausreißen und in den Kaffee tauchen. Alles andre hat der hier unterwegs schon gemacht!"
Als der König dies gehört, trat er mit gekreuzten Armen vor Pechvogel hin und sagte: "Also du bist der Mensch, der die Frechheit gehabt hat, sich von der Prinzessin küssen zu lassen?"
"Ja, Herr König! Und ich bin seitdem der allerglückseligste Mensch der Welt geworden!"
"Werft ihn in den Turm; er soll morgen geköpft werden!"
Hierauf führten die Reiter Pechvogel hinaus und in den Turm; der König aber ging mit langen Schritten in seinem Zimmer auf und ab. "Das ist ein schlimmer Handel", sagte er. "Haben tu' ich ihn, und geköpft wird er; aber davon allein wird mein Glückskind nicht wieder lustig." Dann ging er leise bis an das Zimmer seiner Tochter, sah durchs Schlüsselloch, schüttelte den Kopf, ging wieder lange auf und ab und ließ sich endlich seinen Geheimen Rat kommen.
Als dieser alles gehört, besann er sich und sagte: "Ich weiß nicht, ob's hilft, aber man könnte es versuchen.
Dass der Pechvogel vorher traurig war und jetzt lustig ist, ist sicher; ebenso, dass unsere schöne Prinzessin früher stets fröhlich war und nun fortwährend weint. Dass der Kuss daran schuld ist, ist doch sehr wahrscheinlich. Also, der Pechvogel muss der Prinzessin den Kuss wiedergeben. Majestät, das ist meine untertänigste Meinung!"
"Das ist ja ganz unmöglich", erwiderte der König ärgerlich, "und ganz gegen die Sitte meines Hauses!"
"Eure Majestät müssen die Sache nur als Staatsakt betrachten, dann geht es wohl, und niemand kann etwas dagegen einwenden."
Der König überlegte sich die Angelegenheit noch etwas; dann sagte er: "Gut, wir wollen es versuchen! Rufe alle Grafen und Ritter ins Thronzimmer, und lass den Gefangenen heraufführen!"
Darauf legte der König seine Staatskleidung an und nahm auf dem Throne Platz. Neben ihm stand die Prinzessin, der er gar nicht gewagt hatte zu sagen, weshalb er sie hatte rufen lassen, und um ihn herum in großem Kreise der ganze Hof, lauter vornehme Herren in gold gestickten Kleidern mit Sternen und Schärpen. Alles war ganz still. Da ging die Tür auf, und Pechvogel wurde hereingebracht.
"Du wirst morgen geköpft", fuhr ihn der König an; "aber zuvor wirst du augenblicklich und vor diesen edlen und erlauchten Herren meiner Tochter den Kuss wiedergeben, den sie dir unüberlegterweise gegeben hat!"
"Wenn Ihr nur das wünscht, Herr König", entgegnete Pechvogel, "so will ich es herzlich gern tun, und wenn es möglich ist, dass ein Mensch noch glücklicher werden kann, als ich es jetzt schon bin, so werde ich es gewiss werden!"
"Das wollen wir erst einmal sehen!", unterbrach ihn der König barsch, "diesmal könntest du dich doch verrechnet haben!"
Darauf schritt Pechvogel auf die Prinzessin zu, umarmte sie und gab ihr einen Kuss. Sie aber nahm seine Hand, sah ihn sehr freundlich an, und beide blieben vor dem Throne stehen.
"Bist du nun wieder vergnügt, meine liebe Tochter?", fragte der König.
"Ein kleines bisschen, Herr Vater", entgegnete sie. "Aber es wird gewiss nicht lange anhalten."
"Ja, ja!" sagte der König traurig, "ich sehe es schon. Er ist ja nicht wieder traurig geworden, wie es sein müsste, wenn's richtig wäre! Er steht ja noch immer da und lächelt und macht immer noch das unverschämt vergnügte Gesicht! Was nun anfangen?"
Da schlug die Prinzessin die Augen nieder und sagte leise: "Ich weiß es, Vater, und will es dir sagen, aber bloß ins Ohr!"
Darauf ging der König mit der Prinzessin auf den Vorsaal, und als sie wieder herein traten, nahm er die Hand Pechvogels, legte sie in die der Prinzessin und sagte zu allen den versammelten Herren und Grafen:
"Es ist nicht zu ändern, Gottes Wille geschehe! Dies ist mein lieber Sohn, der König wird, wenn ich einmal sterbe!"
Und Pechvogel wurde Prinz und später König. Er wohnte in dem goldenen Schlosse und gab der Prinzessin, seiner lieben Frau, so viele Küsse, dass sie noch viel fröhlicher wurde als zuvor. Prinzessin Glückskind aber schenkte ihm für seinen hässlichen Namen die allerschönsten, jeden Tag einen andern. Nur zuweilen, wenn sie recht übermütig lustig war, sagte sie zu ihm: "Weißt du noch, wie du früher hießest?" und dann wollte sie sich totlachen. Er aber hielt ihr den Mund zu und sprach: "Still! Was sollen die Leute denken, wenn sie es hören? Sie verlieren ja allen Respekt vor mir!"
![]()
![]()
Ein sehr reicher und vornehmer Ritter lebte in Saus und Braus und war stolz und hart gegen die Armen. Deshalb ließ ihn Gott zur Strafe auf der einen Seite verrosten. Der linke Arm verrostete und das linke Bein, ebenso der Leib bis zur Mitte. Nur das Gesicht blieb frei. Da zog der Ritter an die linke Hand einen Handschuh, ließ ihn am Handgelenk fest zunähen und legte ihn Tag und Nacht nicht ab, damit niemand sah, dass er verrostet war. Darauf ging er in sich und versuchte, einen neuen Lebenswandel anzufangen - er entließ seine alten Freunde und Zechbrüder und nahm sich eine schöne, fromme Frau.
Sie hatte wohl manches Schlimme von dem Ritter gehört, aber weil sein Gesicht gut geblieben war, glaubte sie es, wenn sie allein war, nur halb, und wenn er bei ihr war, gar nicht, denn er war lieb und freundlich zu ihr. Nach der Hochzeit aber merkte sie, warum er niemals den Handschuh auszog und erschrak heftig. Sie ließ sich aber nichts merken, sondern sagte am andern Morgen nur, sie wolle in den Wald gehen und in einer kleinen Kapelle beten. Neben der Kapelle befand sich eine Klause, in der ein alter Eremit lebte, der früher lange in Jerusalem gelebt hatte und so heilig war, dass die Leute von nah und fern zu ihm kamen und ihn um Rat fragten. Zu diesem Einsiedler gedachte die junge Frau des Ritters zu gehen.
Als sie ihm nun alles erzählt hatte, sagte er, nachdem er lange nachgesonnen hatte: „Du kannst deinen Mann erlösen, aber es ist schwer. Fängst du es an und bringst es nicht zu Ende, musst du selber auch verrosten. Dein Mann hat viel Unrecht getan und ist gegen die Armen hart gewesen. Willst du für ihn betteln gehen, barfuß und in Lumpen, bis du hundert Goldgulden erbettelt hast, so ist dein Mann erlöst. Dann nimm ihn bei der Hand, gehe mit ihm in die Kirche und lege das Gold in das Sammelbecken für die Armen. Dann wird der Rost abgehen, und er wird weiß und rein sein wie zuvor!“
„Das will ich tun“, sprach die junge Rittersfrau, „ich will meinen Mann erlösen, denn er ist nur äußerlich verrostet - das glaube ich sicher!“
Darauf ging sie fort und in den Wald hinein, und nicht lange, da begegnete ihr ein altes Mütterchen, das Reisig suchte. Es hatte einen zerlumpten, schmutzigen Rock an und darüber einen aus Flicken zusammengesetzten Mantel, den Regen und Sonnenschein gebleicht hatten.
„Willst du mir deine Kleider geben, alte Mutter“, sagte die junge Frau, »so schenke ich dir alles Geld, was ich in der Tasche habe und meine seidenen Kleider noch dazu, denn ich möchte gern arm werden.“
Die Alte war sehr verwundert darüber, dass jemand, der so jung und schön war, arm werden wollte. Aber als die Rittersfrau begann, ihre Kleider abzulegen und gar ernst und traurig aussah, merkte sie wohl, dass es kein Scherz war. Sie reichte ihr also Rock und Mantel und fragte dann: »Was willst du denn nun tun, mein schönes Töchterchen?“
„Betteln, gute Mutter“, antwortete die Rittersfrau.
„Betteln?“, erwiderte die alte Frau. „Nun, gräme dich nicht, es ist keine Schande! An der Himmelstür wird's auch mancher tun müssen, der es hier nicht gelernt hat. Aber das Bettellied will ich dich erst noch lehren:Betteln und lungern, Dursten und hungern.
Immerdar, alle Zeit müssen wir Bettelleut!
Habt ihr was, schenkt mir was! Ach, nur ein Häppchen!
Brot in den Bettelsack, Suppe ins Näpfchen!
Lederne Ranzen, Röcke mit Fransen,
Tragen wir Bettelleut.
Was man erbettelt hat, Wird verjuchheit!
Nicht wahr, das ist ein hübsches Lied?“, fragte die Alte, dann warf sie sich die seidenen Kleider um, sprang in den Busch und war verschwunden.
Die Rittersfrau aber wanderte durch den Wald, und nach einiger Zeit begegnete ihr ein Bauer, der war ausgegangen, eine Magd zu suchen, denn es war um die Ernte. Da blieb die junge Frau stehen und sagte: „Habt ihr was, schenkt mir was, nur ein Häppchen!“
Aber die anderen Verse sagte sie nicht, weil sie ihr nicht gefielen.
Der Bauer sah sich die Frau an, und da er fand, dass sie trotz ihrer Lumpen schmuck und sauber war, fragte er sie, ob sie sich nicht bei ihm als Magd verdingen wolle.
Aber die Rittersfrau schüttelte den Kopf: „Ich muss betteln gehn, der liebe Gott will es so haben!“
Darüber wurde der Bauer zornig, schimpfte und sagte höhnisch: „Der liebe Gott will's so haben? Du hast wohl mit ihm zu Mittag gegessen? Linsen mit Bratwurst vielleicht? Oder bist du vielleicht seine Muhme, dass du's so genau weißt? Eine faule Haut bist du!“
Damit ging er und ließ sie stehen. Da merkte sie, dass das Betteln nicht leicht war, ging weiter und kam an eine Stelle, wo die Straße sich teilte und zwei Steine standen. Auf dem einen saß ein Bettler mit einer Krücke. Da sie müde geworden war, wollte sie sich auf den freien Stein setzen. Kaum hatte sie dies aber getan, als der Bettler mit der Krücke nach ihr schlug und ihr zurief: „Mach, dass du fort kommst, du liederliche Liese! Willst mir wohl mit deinen Lumpen und deinem zuckersüßen Gesicht die Kundschaft weglocken? Die Ecke hier habe ich gepachtet! Fort mit dir, sonst sollst du sehen, was mein Krückstock für ein schöner Fiedelbogen ist und dein Rücken für eine närrische Geige!“
Da seufzte die Rittersfrau, stand auf und ging, so weit ihre Füße sie tragen wollten. Endlich kam sie in eine große, fremde Stadt. Hier blieb sie, setzte sich an den Kirchweg und bettelte. Nachts schlief sie auf den Kirchenstufen. So lebte sie tagaus, tagein, und der eine schenkte ihr einen Pfennig und der andere einen Heller, manche gaben ihr aber auch nichts oder schimpften, wie der Bauer es getan hatte. Es ging sehr, sehr langsam mit den hundert Gulden, denn als sie dreiviertel Jahr gebettelt hatte, war erst ein einziger Gulden erspart. Und genau, wie das geschehen war, gebar sie einen wunderschönen Knaben, den nannte sie „Docherlöst“, weil sie hoffte, ihren Mann doch noch erlösen zu können.
Sie riss sich von ihrem Mantel einen Streifen ab, wickelte das Kind hinein, nahm es auf den Schoß und bettelte weiter. Und wenn der Kleine nicht schlafen wollte, sang sie:
„Schlaf ein auf meinem Schoße, Du armes Bettelkind,
dein Vater wohnt im Schlosse Und draußen weht der Wind.
Er geht in Samt und Seide, Trinkt Wein, isst weißes Brot,
und säh er uns so beide, so härmt er sich zu Tod.
Er braucht sich nicht zu härmen, su liegst ja weich und warm.
Er ist ja noch viel ärmer, dass Gott sich sein erbarm!“Da blieben die Leute oft stehen und besahen sich die junge Bettelfrau mit dem wunderschönen Kind und schenkten ihr mehr als früher. Sie aber war getrost und weinte nicht mehr, denn sie wusste, wenn sie aushielt, würde sie ihren Mann gewiss erlösen.
Als seine Frau nicht zurückkehrte, wurde der Ritter tiefbetrübt, denn er sagte sich, sie habe alles gemerkt und ihn deshalb verlassen. Er ging zuerst in den Wald zu dem Eremiten, um zu hören, ob sie in der Kapelle gewesen sei und dort gebetet habe.
Aber der Einsiedler war sehr streng und kurz angebunden mit ihm: „Hast du nicht in Saus und Braus gelebt? Bist du nicht stolz und hart gegen die Armen gewesen? Hat dich der liebe Gott nicht zur Strafe verrosten lassen? Deine Frau hat recht daran getan, dass sie dich verließ.“
Da setzte sich der Ritter auf die Erde, nahm den Helm ab und weinte bitterlich. Als der Eremit das sah, wurde er freundlicher und sprach: „Da ich sehe, dass dein Herz nicht mit verrostet ist, so will ich dir raten. Tue Gutes und gehe in die Kirchen, dann wirst du deine Frau wiederfinden!“
Da verließ der Ritter sein Schloss und ritt in die Welt hinaus. Wo er Arme fand, beschenkte er sie, und wenn er eine Kirche sah, ging er hinein und betete. Aber seine Frau fand er nicht.
So war fast ein Jahr vergangen, da kam er auch in die Stadt, wo seine Frau am Kirchweg saß und bettelte. Schon von weitem erkannte sie ihren Mann, denn er war groß und stattlich und trug einen goldenen Helm, der weithin leuchtete. Sie erschrak sehr, denn sie hatte erst zwei Goldgulden beisammen, so dass sie ihn nicht erlösen konnte. Sie zog sich den Mantel tief über den Kopf und kauerte sich eng zusammen, damit er sie nicht erkennen sollte.
Als aber der Ritter an ihr vorbei schritt, hörte er sie leise schluchzen, und als er ihren zerlumpten, geflickten Mantel sah und das wunderschöne Kind auf ihrem Schoß, das ebenfalls nur in jämmerliche Lumpen gewickelt war, tat es ihm in der Seele weh. Er trat heran und fragte, was ihr fehle. Doch die Frau antwortete nicht und schluchzte nur noch mehr, so sehr sie sich auch bemühte, es zu unterdrücken.
Da zog der Ritter seine Geldtasche hervor, in der viel mehr war als hundert Goldgulden, legte sie ihr auf den Schoß und sagte: „Ich gebe dir alles, was ich noch habe, und sollte ich mich nach Hause durchbetteln müssen!“
Da fiel der jungen Frau, ohne dass sie es merkte, der Mantel herunter, und der Ritter sah, dass es sein eigenes Eheweib war, der er das Geld geschenkt hatte. Trotz der Lumpen fiel er ihr um den Hals und küsste sie, und als er in dem Kind seinen Sohn erkannte, herzte er es auch. Doch die Frau nahm ihren Mann bei der Hand, führte ihn in die Kirche und legte das Geld in das Sammelbecken für die Armen.
Dann sprach sie: „Ich wollte dich erlösen - aber du hast dich selbst erlöst!“
Und so war es, denn als der Ritter aus der Kirche trat, war der Fluch von ihm genommen und der Rost, der seine linke Seite bedeckt hatte, verschwunden. Er hob Frau und Kind auf sein Pferd, ging selbst zu Fuß daneben und zog zurück zum Schloss, wo er viele Jahre glücklich mit den Seinen lebte und so viel Gutes tat, dass ihn die Leute weit und breit lobten.
Die Lumpen aber, die seine Frau getragen hatte, hängte er in einen kostbaren Schrein, und er sagte jeden Morgen, wenn er sie betrachtete: „Das ist meine Morgenandacht, die nimmt mir der liebe Gott nicht übel, denn er weiß, wie ich's meine, und ich gehe nachher doch noch in die Kirche!“
![]()
![]()
Es war um die Zeit, da die Erde am allerschönsten ist und es dem Menschen am schwersten fällt zu sterben; denn der Flieder blühte schon, und die Rosen hatten dicke Knospen. Da zogen zwei Wanderer die Himmelsstraße entlang, ein Armer und ein Reicher. Die hatten auf Erden dicht beieinander in derselben Straße gewohnt, der Reiche in einem großen, prächtigen Hause und der Arme in einer kleinen Hütte. Weil aber der Tod keinen Unterschied macht, so war es geschehen, dass sie beide zu derselben Stunde starben.
Da waren sie nun auf der Himmelsstraße auch wieder zusammengekommen und gingen schweigend nebeneinander her.
Doch der Weg wurde steiler und steiler, und dem Reichen begann es bald blutsauer zu werden; denn er war dick und kurzatmig und in seinem Leben noch nie so weit gegangen. Da trug es sich zu, dass der Arme bald einen guten Vorsprung gewann und zuerst an der Himmelspforte ankam. Weil er sich aber nicht getraute anzuklopfen, setzte er sich still vor der Pforte nieder und dachte: "Du willst auf den reichen Mann warten; vielleicht klopft der an."
Nach langer Zeit langte der Reiche auch an, und als er die Pforte verschlossen fand und als nicht gleich jemand aufmachte, fing er laut an zu rütteln und mit der Faust daran zu schlagen. Da stürzte Petrus eilends herbei, öffnete die Pforte, sah sich die beiden an und sagte zu dem Reichen: "Das bist du gewiss gewesen, der es nicht erwarten konnte! Ich dächte, du brauchtest dich nicht so breit zu machen. Viel Gescheites haben wir hier oben von dir nicht gehört, solange du auf der Erde gelebt hast!"
Da fiel dem Reichen gewaltig der Mut; doch Petrus kümmerte sich nicht weiter um ihn, sondern reichte dem Armen die Hand, damit er leichter aufstehen konnte, und sagte: "Tretet nur alle beide ein in der Vorsaal; das Weitere wird sich schon finden!"
Und es war auch wirklich noch gar nicht der Himmel, in den sie jetzt eintraten, sondern nur eine große, weite Halle mit vielen verschlossenen Türen und mit Bänken an den Wänden.
"Ruht euch ein wenig aus", nahm Petrus wieder das Wort, "und wartet, bis ich zurückkomme; aber benutzt eure Zeit gut, denn ihr sollt euch mittlerweile überlegen, wie ihr es hier oben haben wollt. Jeder von euch soll es genau so haben, wie er sich es selber wünscht. Also bedenkt's, und wenn ich wiederkomme, macht keine Umstände, sondern sagt's, und vergesst nichts; denn nachher ist' s zu spät."
Damit ging er weg. Als er dann nach einiger Zeit zurückkehrte und fragte, ob sie fertig wären mit überlegen und wie sie es sich in der Ewigkeit wünschten, sprang der reiche Mann von der Bank auf und sagte, er wolle ein großes, goldenes Schloss haben, so schön, wie der Kaiser keins hätte, und jeden Tag das beste Essen. Früh Schokolade und mittags einen Tag um den andern Kalbsbraten mit Apfelmus und Milchreis mit Bratwürsten und nachher rote Grütze. Das wären seine Leibgerichte. Und abends jeden Tag etwas andres. Weiter wollte er dann einen recht schönen Großvaterstuhl und einen grünseidenen Schlafrock; und das Tageblättchen solle Petrus auch nicht vergessen, damit er doch wisse, was passiere.
Da sah ihn Petrus mitleidig an, schwieg lange und fragte endlich: "Und weiter wünschest du dir nichts?“ „0 ja!", fiel rasch der Reiche ein, "Geld, viel Geld, alle Keller voll; so viel, dass man es gar nicht zählen kann!"
"Das sollst du alles haben", entgegnete Petrus; "komm, folge mir!" Und er öffnete eine der vielen Türen und führte den Reichen in ein prachtvolles, goldenes Schloss, darin war alles so, wie jener es sich gewünscht hatte. Nachdem er ihm alles gezeigt, ging er weg und schob vor das Tor des Schlosses einen großen eisernen Riegel. Der Reiche aber zog sich den grünseidenen Schlafrock an, setzte sich in den Großvaterstuhl, aß und trank und ließ sich's gutgehen, und wenn er satt war, las er das Tageblättchen. Und jeden Tag einmal stieg er hinab in den Keller und besah sein Geld.
Und zwanzig und fünfzig Jahre vergingen und wieder fünfzig, so dass es hundert waren - und das ist doch nur eine Spanne von der Ewigkeit - da war der reiche Mann seines prächtigen, goldenen Schlosses schon so überdrüssig, dass er es kaum mehr aushalten konnte. "Der Kalbsbraten und die Bratwürste werden auch immer schlechter", sagte er, "sie sind gar nicht mehr zu genießen!" Aber es war nicht wahr, sondern er hatte sie nur satt. "Und das Tageblättchen lese ich schon lange nicht mehr", fuhr er fort; "es ist mir ganz gleichgültig, was da unten auf der Erde sich zuträgt. Ich kenne ja keinen einzigen Menschen mehr! Meine Bekannten sind schon längst alle gestorben. Die Menschen, die jetzt leben, machen so närrische Streiche und schwatzen so sonderbares Zeug, dass es einem schwindelig wird, wenn man's liest." Darauf schwieg er und gähnte, denn es war sehr langweilig, und nach einer Weile sagte er wieder: "Mit meinem vielen Gelde weiß ich auch nichts anzufangen. Wozu hab' ich's eigentlich? Man kann sich hier doch nichts kaufen! Wie ein Mensch nur so dumm sein kann und sich Geld im Himmel wünschen!" Dann stand er auf, öffnete das Fenster und sah hinaus.Aber obschon es in dem Schlosse überall hell war, so war es doch draußen stockdunkel- stockdunkel, so dass man die Hand vorm Auge nicht sehen konnte, stockdunkel, Tag und Nacht, jahraus, jahrein, und so still wie auf dem Kirchhof. Da schloss er das Fenster wieder und setzte sich aufs Neue auf seinen Großvaterstuhl, und jeden Tag stand er ein- oder zweimal auf und sah wieder hinaus. Aber es war noch immer so. Und immer früh Schokolade und mittags einen Tag um den andern Kalbsbraten mit Apfelmus und Milchreis mit Bratwürsten und nachher rote Grütze; immerzu, immerzu, einen Tag wie den andern.
Als jedoch tausend Jahre vergangen waren, klirrte der große eiserne Riegel am Tor, und Petrus trat ein. "Nun", fragte er, "wie gefällt es dir?"
Da wurde der reiche Mann bitterböse: "Wie mir's gefällt? Schlecht gefällt mir's, ganz schlecht! So schlecht, wie es einem nur in so einem nichtswürdigen Schlosse gefallen kann! Wie kannst du dir nur denken, dass man es hier tausend Jahre aushalten kann! Man hört nichts, man sieht nichts; niemand bekümmert sich um einen. Nichts als Lügen sind es mit eurem vielgepriesenen Himmel und mit eurer ewigen Glückseligkeit! Eine ganz erbärmliche Einrichtung ist es!"
Da blickte ihn Petrus verwundert an und sagte: "Du weißt wohl gar nicht, wo du bist? Du denkst wohl, du bist im Himmel? In der Hölle bist du! Du hast dich ja selbst in die Hölle gewünscht! Das Schloss gehört zur Hölle."
"Zur Hölle?", wiederholte der Reiche erschrocken. "Das hier ist doch nicht die Hölle? Wo sind denn der Teufel und das Feuer und die Kessel?"
"Du meinst wohl", entgegnete Petrus, "dass die Sünder jetzt immer noch gebraten werden, wie früher? Das ist schon lange nicht mehr so. Aber in der Hölle bist du, verlass dich darauf, und zwar recht tief drin, so dass du einen schon dauern kannst. Mit der Zeit wirst du's wohl selbst innewerden."
Da fiel der reiche Mann entsetzt rückwärts in seinen Großvaterstuhl, hielt sich die Hände vors Gesicht und schluchzte: "In der Hölle, in der Hölle! Ich armer, unglücklicher Mensch, was soll aus mir werden?"
Aber Petrus machte die Tür auf und ging weg, und als er den eisernen Riegel draußen wieder vorschob, hörte er drinnen den Reichen immer noch schluchzen: "In der Hölle! In der Hölle! Ich armer, unglücklicher Mensch, was soll aus mir werden?"
Und wieder vergingen hundert Jahre und aber hundert, und die Zeit wurde dem reichen Manne so entsetzlich lang, wie niemand es sich auch nur denken kann. Und als das zweite Tausend zu Ende kam, trat Petrus abermals ein.
"Ach", rief ihm der reiche Mann entgegen, "ich habe mich so sehr nach dir gesehnt! Ich bin sehr traurig! Und so wie jetzt soll es immer bleiben? Die ganze Ewigkeit?" Und nach einer Weile fuhr er fort: "Heiliger Petrus, wie lang ist wohl die Ewigkeit?"
Da antwortete Petrus: "Wenn noch zehntausend Jahre vergangen sind, fängt sie an."
Als der Reiche dies gehört hatte, ließ er den Kopf auf die Brust sinken und begann bitterlich zu weinen. Aber Petrus stand hinter seinem Stuhl und zählte heimlich seine Tränen, und als er sah, dass es so viele waren, dass ihm der liebe Gott gewiss verzeihen würde, sprach er: "Komm, ich will dir einmal etwas recht Schönes zeigen! Oben auf dem Boden weiß ich ein Astloch in der Wand, da kann man ein wenig in den Himmel hineinsehen."
Damit führte er ihn die Bodentreppe hinauf und durch allerhand Gerümpel bis zu einer kleinen Kammer. Als sie in diese eintraten, fiel durch das Astloch ein goldener Strahl hindurch dem heiligen Petrus gerade auf die Stirn, so dass es aussah, als wenn Feuerflammen auf ihr brennten.
"Das ist vom wirklichen Himmel!", sagte der reiche Mann zitternd.
"Ja", erwiderte Petrus, "nun sieh einmal hindurch!"
Aber das Astloch war etwas hoch oben an der Wand, und der reiche Mann war nicht sehr groß, so dass er kaum hinaufreichte.
"Du musst dich recht lang machen und ganz hoch auf die Zehen stellen", sagte Petrus. Da strengte sich der Reiche so sehr an, wie er nur irgend konnte, und als er endlich durch das Astloch hindurchblickte, sah er wirklich in den Himmel hinein. Da saß der liebe Gott auf seinem goldenen Thron zwischen den Wolken und den Sternen in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit und um ihn her alle Engel und Heiligen.
„Ach", rief er aus, "das ist ja so wunderbar schön und herrlich, wie man es sich auf der Erde gar nicht vorstellen kann! Aber sage, wer ist denn das, der dem lieben Gott zu Füßen sitzt und mir gerade den Rücken zukehrt?"
"Das ist der arme Mann, der auf der Erde neben dir gewohnt hat und mit dem zusammen du heraufgekommen bist. Als ich euch auftrug, es euch auszudenken, wie ihr es in der Ewigkeit haben wolltet, hat er sich bloß ein Fußbänkchen gewünscht, damit er sich dem lieben Gott zu Füßen setzen könne. Und das hat er auch bekommen, genau so, wie du dein Schloss."
Als er dies gesagt hatte, ging er still weg, ohne dass es der Reiche merkte. Denn der stand immer noch ganz still auf den Fußspitzen und blickte in den Himmel hinein und konnte sich nicht satt sehen. Zwar es fiel ihm recht schwer, denn das Loch war sehr hoch oben, und er musste fortwährend auf den Zehen stehen; aber er tat es gern, denn es war zu schön, was er sah.
Und nach abermals tausend Jahren kam Petrus zum letzten Mal. Da stand der reiche Mann immer noch in der Bodenkammer an der Wand auf den Fußspitzen und schaute unverwandt in den Himmel hinein und war so ins Sehen versunken, dass er gar nichts merkte, als Petrus eintrat.
Endlich legte ihm aber Petrus die Hand auf die Schulter, dass er sich umdrehte, und sagte: "Komm mit, du hast nun lange genug gestanden! Deine Sünden sind dir vergeben; ich soll dich in den Himmel holen. -- Nicht wahr, du hättest es viel bequemer haben können, wenn du nur gewollt hättest?"
Franz Xaver von Schönwerth wurde am 16. Juli 1810 in Amberg geboren – nach anderen Angaben 1809. Am 24. Mai 1886 starb der bekannteste Oberpfälzer Volkskundler in München. Sein dreibändiges Werk „Aus der Oberpfalz – Sitten und Sagen“ entstand durch seine Beobachtungen der Bevölkerung und deren Leben.
Er zeichnete Sagen, Märchen, Schwänke, Kinderspiele, Kinderreime und –lieder, sowie Sprichwörter auf.
![]()
![]()
Einst lebte ein armer Bauer, der sprach zu seinem einzigen Sohne: "Hansel, du bist nun groß geworden, und ich kann dich nicht mehr ernähren. Ich möchte dich wohl gern bei mir behalten; aber es geht nicht. Du musst in die Welt ziehen und dir dein Brot selber verdienen!"
Hansel war einverstanden und nahm schon andern Tages Abschied von daheim, und der Vater gab ihm als einzige Habe zwei Kutten mit in die Fremde, eine blaue und eine weiße.
Er wanderte immer getrost der Nase nach, denn wer kein Ziel hat, ist immer auf dem rechten Wege, und so gelangte er nach einiger Zeit in einen großen, wilden Wald. Da gab es weder Straßen noch Herbergen, und Hansel verirrte sich, lief kreuz und quer und meinte schon, er würde wohl zeitlebens nicht wieder zu den Menschen gelangen. Endlich aber, als es schon Abend ward, kam er doch zu einer Hütte. Darinnen traf er eine alte Frau, die bat er sterbensmatt um ein Stück Brot und um ein Nachtlager.
Das Brot bekam er sogleich; aber die Alte warnte ihn sehr, in der Hütte zu übernachten, da ihr Mann ein Hexenmeister sei, der ihm leicht ein Leid zufügen könnte.
Hansel jedoch fühlte sich so müde, dass er nicht wieder in den finstern Wald hinaus mochte, und er redete der Frau so lange zu, bis sie einwilligte und ihm ein Plätzchen zum Schlafen anwies.
Hier schlummerte er tief und sorglos bis in den hellen Tag.
Da rüttelte ihn jemand lange und kräftig, und als er aufwachte, stand der Hexenmeister an seinem Lager. Der tat ihm aber nichts Böses, sondern er betrachtete ihn aufmerksam und fragte ihn schließlich, ob er bei ihm bleiben und sein Diener werden wolle.
Hansel besann sich nicht lange und sagte beherzt: "Ja, das will ich gern tun!"
"Kannst du aber auch lesen?", fuhr der Zauberer fort. "Freilich kann ich's", meinte Hansel, "das hab' ich in meinem Dorfe wohl gelernt!"
"So pack' dich!", rief der Hexenmeister; "einen solchen Diener kann ich nicht brauchen!" Denn er fürchtete, Hansel könnte in seinen Zauberbüchern lesen und daraus gar klug und wohl selbst ein rechter Zaubermann werden.
Betrübten Herzens schlich Hansel von dannen. Im Walde aber kam ihm ein kluger Einfall. Er zog seine blaue Kutte aus und bekleidete sich mit der weißen, die er bisher im Felleisen getragen hatte, und am Abend kehrte er zur Hütte zurück.
Wirklich erkannten ihn weder die Frau noch der Zauberer, und er wurde wieder aufgenommen.
Am nächsten Morgen richtete der Hexenmeister die gleichen Fragen an ihn. Aber diesmal war Hansel klug, und als vom Lesenkönnen die Rede war, sagte er: "Lesen? Ach, du meine Güte, das ist etwas für die gelehrten Leute! Ich hab' es mein Lebtag nicht gelernt!"
Da freute sich der Hexenmeister und behielt ihn gegen guten Lohn auf drei Jahre als Diener.
Hansel war fleißig und erfüllte pünktlich und gewissenhaft alle Aufträge seines Herrn. Wenn dieser aber nicht daheim war, las er eifrig in den Zauberbüchern und wusste bald mehr als der Meister.
Nach Ablauf der drei Jahre nahm er seinen Lohn in Empfang und kehrte zu seinem Vater zurück. Dem gab er sein verdientes Geld, und sie lebten vergnügt miteinander, bis der Lohn verbraucht und aufgezehrt war. Nun kratzte sich der Vater ratlos hinter dem Ohre; aber Hansel sagte: "Sei ohne Sorge, Vater! Ich werde der Not schon abhelfen!"
Nun war am folgenden Tage im Nachbarorte Saumarkt.
Da sprach er: "Hör' gut zu, Vater! Ich verwandele mich in eine Sauherde. Die treibst du auf den Markt und verkaufst sie. Das kleinste Ferkel aber behältst du und bringst es wieder mit nach Hause; denn das bin ich, der Hansel!" Der Vater tat, was ihm der Sohn geraten, verkaufte die Herde zu einem guten
Preise und trug das kleinste Ferkel wieder heim. Dort wurde es wieder der Hansel, und sie lachten beide und freuten sich über die wohlgefüllte Geldkatze.
Aber endlich ging auch dieses Geld wieder zu Ende, und abermals begann der Bauer sich hinter dem Ohr zu kratzen. Hansel aber meinte: "Wenn nur bald Viehmarkt wäre, so wüsste ich schon, was ich täte!"
Wirklich war nach einigen Tagen Viehmarkt, und Hansel sagte: "Vater, ich verwandele mich in ein Paar schöner Ochsen. Die verkaufst du. Behalte aber den Strick, und nimm ihn wieder mit nach Hause; denn das bin ich, der Hansel."
Der Bauer tat auch diesmal nach den Worten des Sohnes.
Die schönen Ochsen fanden bald einen Liebhaber, der einen guten Preis bezahlte. Der Vater aber ging heim mit dem vielen Gelde und dem Stricke, der sich wieder in den Hansel verwandelte.
Nach einiger Zeit ging es jedoch abermals knapp her. Darum sprach Hansel: "Ich wollte, es wäre bald ein Rossmarkt; ich könnte dann schon helfen!" Endlich war der Tag des Rossmarktes da. Der Vater trieb den Hansel diesmal als einen schmucken Schimmel zum Markte; doch hatte ihm der Junge aufgetragen: "Den Zaum behalte ja, und nimm ihn wieder mit heim; denn das bin ich, der Hansel!"
Nun aber war im Gewimmel der Pferde und der Rosshändler auch der Hexenmeister anwesend. Er kannte den Schimmel sogleich; denn dieser war ja nach den Regeln seiner eigenen Kunst verzaubert worden. Darum feilschte er um das Pferd, um es in seinen Besitz zu bringen und den Hansel strafen zu können. Er wurde auch bald mit dem Bauer handelseins.
Als der aber dem Schimmel den Zaum abnehmen wollte, ließ es der Hexenmeister nicht zu, sondern sprach: "Nichts da! Der Zaum gehört dazu! Ich habe das Pferd bezahlt, wie es hier steht!" Dagegen konnte der Bauer nichts tun, und er zog traurig mit seinem Gelde, aber ohne den Hansel heim. Doch frohlockend trieb der Zauberer seinen früheren Diener vom Markte hinweg.
Hansel freilich gab sich noch nicht verloren. Unterwegs nagte der Schimmel so lange und heftig an dem Zaum, dass dieser plötzlich zu Boden fiel, und ehe der Zauberer nach ihm griff; sprang Hansel schon als Eichhörnchen davon und kletterte an einem Holzbirnbaum empor, der da am Wege stand. Der Meister aber verwandelte sich blitzschnell in einen Marder und eilte ihm nach.
Als Hansel auf dem Gipfel des Baumes angelangt war, nicht mehr weiterkonnte und den blutdürstigen Räuber hinter sich sah, nahm er durch seine Zauberkraft die Gestalt einer Schwalbe an und sauste davon. Aber im Augenblick schoss ihm der Meister auch schon als Habicht nach. Das war eine hitzige Jagd! Bald wusste die Schwalbe nicht mehr recht, wohin sie sich retten sollte. Endlich sah sie auf einem Hügel ein Schloss, und an einem offenen Fenster saß eine holde Prinzessin und stickte. Da flog ihr die Schwalbe in den Schoß und rief: "Rette mich! Ich werde hart verfolgt! Ich verwandele mich jetzt in einen Ring; den stecke schnell an deinen Finger. Kommt jemand und will mich dir abkaufen, so sage, der Ring sei dir nur um einen Sack voll Gold feil. Bringt er diesen, so gib ihm dennoch den Ring nicht in die Hand, sondern schleudere ihn so vom Finger, dass er zu Boden fällt." Im Nu ward nun die Schwalbe zu einem schönen Ring, und die Prinzessin steckte ihn eilig an ihr schlankes Goldfingerlein.
Da klopfte es auch schon am Tore, und bald trat der Zauberer, als alter Händler angetan, in das Gemach. Er verbeugte sich tief und bat die Prinzessin, ihm den schönen Ring zu verkaufen. Diese verlangte aber einen großen Sack voll Gold dafür. Der Hexenmeister ließ sich dadurch nicht beirren, verließ das Schloss für ein paar Augenblicke und schleppte dann wirklich den Goldsack herbei.
Nun schleuderte die Prinzessin, wie ihr's geheißen worden, den Ring vom Finger. Er fiel auf den Boden und zerstob in eine Unzahl winzig kleiner Hirsekörnlein. Da verwandelte sich der Händler rasch in einen Hahn und begann eiligst die Körnlein aufzupicken. Bevor er aber das richtige Hirsekorn erwischte, in dem der Hansel steckte, machte sich dieser zu einem Fuchs, sprang auf den Gockel zu, biss ihm den Hals ab und fraß ihn auf.
Dann wurde der Fuchs wieder zum Hansel. Die holde, hilfsbereite Prinzessin aber ward seine Gemahlin, und Hansels guter Vater kam zur Hochzeit ins Schloss und blieb auch bei seinen Kindern darinnen wohnen bis an sein Lebensende.
Schweizer Pädagoge (1832 - 1901)
![]()
![]()
Ein König hatte einen jungen Edelknecht, den man Junker Prahlhans nannte, weil er immer viel versprach und wenig hielt. Es lebte aber am Hofe des Königs auch ein Spaßmacher, der hatte nicht nur einen feinen Kopf und eine gewandte Zunge, sondern auch ein gutes Herz, und weil er meinte, es könnte dem Junker einmal übel ergehen mit seiner Prahlerei, so nahm er sich vor, ihn zu bessern.
Eines Tages hätte der König gern gebratene Vögel gegessen und sprach zum Junker: "Hans, geh hinaus in den Wald, und schieße mir zehn Vögel für meinen Tisch!"
Der Junker aber, den das gar wenig dünkte, nahm den Mund gewaltig voll und sprach: "Nicht nur zehn, sondern hundert Vögel will ich dir schießen!"
"Gut", sprach der König, "wenn du ein so guter Schütze bist, so bring' mir hundert; sollst für jeden einen Taler haben!"
Der alte Spaßmacher hatte alles wohl vernommen und ging eilig dem Junker voraus in den Wald, wo die meisten Vögel waren, und rief ihnen zu:"Ihr Vöglein, flieget alle fort!
Hans Großmaul kommt an diesen Ort,
rnöcht' hundert Vögel schießen!"Als aber der Junker Hans in den Wald kam, da konnte er keinen einzigen Vogel erspähen; denn sie hatten sich alle in ihren Nestern versteckt. So kam er mit leeren Taschen zum König zurück, und er wurde auf hundert Tage ins Gefängnis gesteckt, weil er sein Wort nicht gehalten hatte.
Als er wieder frei war, sagte eines Tages der König: "Ich möchte heute wohl fünf Fische auf meinem Tische haben!"
Da gedachte Junker Hans an seine hundert Tage Gefängnis und tat seinem Munde ein wenig den Zaum an. "Ich will dir fünfzig Fische fangen statt fünf!", sagte er zu seinem Herrn.
Da sprach der König: "Wenn du ein so guter Fischer bist, so fange mir fünfzig; sollst für jeden ein Goldstück haben!"
Wieder aber eilte der Spaßmacher voraus, ging an den See und rief den Fischen zu:"Ihr Fischlein, schwimmet alle fort!
Hans Großmaul kommt an diesen Ort,
möcht' fünfzig Fische fangen!"Als nun der Junker an den See kam, da konnte er kein einziges Fischlein fangen; denn sie waren alle ans andere Ufer hinübergeschwommen. So kam er wiederum mit leeren Taschen heim, und der König ließ ihn fünfzig Tage lang einsperren, weil er sein Wort nicht gehalten hatte.
Nachdem die fünfzig Tage um waren, sprach der König: "Ich möchte wohl einen Hasen für meinen Tisch haben!"
Junker Hans gedachte seines Gefängnisses und hütete sich wohl, gar zu viel zu versprechen.
"Herr", sprach er, "ich will dir doch wenigstens zehn Hasen bringen!"
"Gut", antwortete der König, "wenn du ein so guter Jäger bist, so jage mir zehn; sollst für jeden ein Doppelgoldstück haben!"
Und zum drittenmal ging der Spaßmacher voraus, eilte auf das Feld und rief den Hasen zu:"Ihr Häslein, springet alle fort!
Hans Großmaul kommt an diesen Ort
und möcht' zehn Hasen jagen!"Als dann der Junker kam, konnte er den ganzen Tag keinen einzigen Hasen erjagen. Wieder kam er mit leeren Händen heim, und der König ließ ihn zehn Tage lang einsperren, weil er sein Wort nicht gehalten hatte.
Als er wieder frei war, sprach der König: "Ich möchte wohl einen Hirsch für meinen Tisch haben!"
Der Junker aber gedachte an der Leiden, die seine Prahlerei ihm schon verursacht hatte, und sagte bescheidentlich: "Ich will hingehen und schauen, ob ich einen Hirsch erlegen kann."
Und als er hinging, konnte er wirklich einen schießen und brachte ihn mit Freuden dem König. Der lachte und sprach: "Schau, wenn man nichts Unmögliches verspricht, so ist das Worthalten leicht!"
Der Spaßmacher aber lachte sich ins Fäustchen; denn der Junker war von jetzt an bescheiden.
Charles Perrault wurde am 12.1.1628 in Paris geboren und starb in der Nacht vom 15. auf den 16.5. 1703.
Berühmt wurde er durch seine Märchensammlung (Contes de Fées, „Feenerzählungen“).
Deutsche Autoren wie Brüder Grimm oder Ludwig Bechstein sind von ihm stark beeinflusst.
![]()
![]()
Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne. Als er nun starb, hinterließ er ihnen seine Mühle, einen Esel und einen großen Kater. Und wie es der Vater bestimmt hatte, so bekam der älteste Sohn die Mühle, der zweite den Esel und der jüngste den Kater namens Peter.
Das erschien dem armen Jungen nun wenig genug; denn er meinte, dass das Katzenfell höchstens eine warme Mütze gebe und dass sonst nichts weiter mit dem Tiere anzufangen sei.
Den Kater aber rührte die Not seines Herrn, und er sprach: "Sei doch nicht traurig! Gib mir nur einen Sack und ein Paar derber Stiefel, so sollst du sehen, dass ich nicht gar so unnütz bin!"
Der Müllerssohn dachte an die große Schlauheit und den festen Mut des Katers, der nicht nur ein rechter Mäuseschreck war, sondern den auch alle seine Feinde fürchteten, und er erfüllte seine Wünsche genau.
Sogleich zog der Kater Peter die Stiefel an, nahm den Sack auf die Schulter und marschierte hinaus aufs Feld. In einem Gebüsch breitete er den Sack wie eine Falle aus, legte saftige Kohlblätter und grünes Leckerwerk hinein und brachte mit großer Kunstfertigkeit eine Schnur an, mit der er die Falle zuziehen konnte. Dann streckte er sich wie tot hinter einen Strauch und rührte und regte sich nicht, behielt aber die Leine fest in der Hand. Es dauerte auch gar nicht lange, so kam ein junges Kaninchen, schnupperte an dem leckeren Grünzeug, begann daran zu knabbern und ließ sich verleiten, in den offenen Sack hineinzuschlüpfen. In diesem Augenblicke zog Peter an der Schnur; der Sack war zu, und das Kaninchen war gefangen.
Der Kater tötete das vorwitzige Ding und ging mit seiner Beute spornstreichs zum König des Landes. Der saß auf seinem goldenen Throne.
Peter aber verneigte sich ehrerbietig und tief und sprach: "Mein Herr, der Graf von Siebenreich, hat mir befohlen, Euch dieses Kaninchen zu überreichen."
Der König freute sich über diese unerwartete Aufmerksamkeit, dankte mit freundlichen Worten und gebot dem Kater, dem Herrn Grafen seinen königlichen Gruß zu überbringen.
Am nächsten Tage versteckte sich der Kater in einem Getreidefeld. Der Sack lag offen neben ihm, und diesmal hatte Peter das Glück, zwei Wachteln zu fangen. Wieder brachte er sie dem König im Namen seines Herrn, des Grafen von Siebenreich. Der Herrscher nahm sie voll Freude für seine Tafel in Empfang und ließ dem gestiefelten Kater ein Goldstück zum Lohne reichen.
So fuhr nun der Kater fort, dem Könige von Zeit zu Zeit Wildbret ins Schloss zu tragen als Gabe seines Herrn, des Grafen von Siebenreich. .
Der König aber hatte eine Tochter, die war die schönste Prinzessin in aller Welt. Mit dieser wollte er eines Tages am nahen Flusse spazieren fahren. Der Kater, der seine Ohren wohl zu brauchen wusste, hörte rechtzeitig davon und eilte heim zum Müllerburschen. "Höre, mein lieber Herr, wenn du jetzt meinem Rate folgst, so ist dein Glück gemacht! Bade in dem Flusse dort, wo ich dir's zeigen werde, und warte im Wasser ab, was dann geschieht! Alles Übrige werde ich schon tun!" Der Bursche war einverstanden, und als er im Wasser war, fuhr des Königs goldener Wagen vorbei.
Da schrie der Kater aus Leibeskräften: "Hilfe, Hilfe! Mein Herr, der Graf von Siebenreich, der muss ertrinken!"
Der König schaute zum Wagenfenster hinaus, und als er den wohlbekannten Kater sah und von der Gefahr hörte, in welcher der Graf sich befand, ließ er augenblicklich halten und sandte seine Diener zum Flusse, die sollten den Grafen retten. Nun hatte aber der Kater des Müllers ärmliche Kleider versteckt und eilte zur Kutsche des Königs.
"Ach, Eure Majestät", jammerte er, "es haben Diebe meines Herrn Gewand geraubt!"
Da ließ der König vom Schlosse die schönsten Kleider holen, und der Müllerbursche zog sie an.
In diesem kostbaren Gewande sah er nun wirklich wie ein vornehmer Graf aus, und als er an des Königs Kutsche trat, um sich geziemend zu bedanken, da gefiel er dem hohen Herrn über die Maßen wohl. Noch tausendmal besser gefiel er aber der schönen Prinzessin, die ihn immerfort ansehen musste und sehr freundlich zu ihm war.
Der König lud ihn ein, in den Wagen zu steigen und an der Spazierfahrt teilzunehmen.
Der Kater aber lief voraus, und als er Bauern fand, die da Gras abmähten, rief er ihnen zu: "He, ihr Leute, wenn ihr dem König nicht sagt, diese Wiese gehöre dem Grafen von Siebenreich, so sollt ihr kurz und klein geschlagen werden!"
Wirklich fragte dann der König die Bauern, wem die Wiese gehöre, und sie waren so voller Furcht, dass sie antworteten: "Dem Grafen von Siebenreich!"
Inzwischen traf der Kater fleißige Schnitter an, denen rief er zu: "He, ihr Leute, wenn ihr dem König nicht sagt, diese Getreidefelder gehören dem Grafen von Siebenreich, so sollt ihr zu Brei geschlagen werden!"
Da fürchteten sie sich, und als der König sie fragte, antworteten sie: "Die Felder gehören dem Grafen von Siebenreich!"
Zu allen Leuten, die er am Wege sah, sagte der Kater dasselbe, und alle Leute gaben dem König immer wieder die gleiche Antwort, wenn er nach dem Besitzer der Äcker und Wälder, der Höfe und Mühlen, der Herden und Gespanne fragte. Da wunderte sich der Herrscher immer mehr über den reichen Besitz seines Begleiters; nur die Prinzessin kümmerte sich nicht viel darum, weil sie unaufhörlich den schmucken Grafen anblicken musste.
Endlich gelangte der Kater zu einem herrlichen Schlosse, in dem ein mächtiger Zauberer und Menschenfresser wohnte. Der war so reich, dass man es gar nicht sagen konnte; denn ihm gehörte in Wirklichkeit alles Land, durch das der König gefahren war.
Der Kater ging in das Schloss hinein, trat vor den Menschenfresser und sagte: "Großmächtiger Herr und Gebieter, ich freue mich von Herzen, einen so berühmten und gewaltigen Mann mit meinen armseligen Augen sehen zu dürfen!" Diese Anrede stimmte den Zauberer gnädig, und er nahm den seltsamen Gast freundlich auf.
"Mir ist erzählt worden", fuhr der Kater fort, "deine Zauberkunst sei so gewaltig, dass du dich in jedes beliebige Tier verwandeln könntest."
"Gewiss", erwiderte der Zauberer, "das kann ich", und alsbald stand er in Gestalt eines riesigen Löwen vor dem Kater. Der erschrak so sehr, dass er in einem mächtigen Satze zum Fenster hinaus sprang und sich in der Dachrinne verkroch.
Da nahm der Zauberer seine vorige Gestalt wieder an, und er brüllte vor Lachen über des Katers Schrecken.
Der kam zagend wieder herein und sprach dann listig: "Ihr waret als Löwe so herrlich, so erhaben und furchterregend, wie es einem so mächtigen Manne zukommt! Nun hat man mir aber auch gesagt, Ihr könntet Euch mit gleicher Leichtigkeit in ein winziges Mäuslein verwandeln. Aber nein, das kann ich nun und nimmermehr glauben!"
"Dummkopf!", schrie der Zauberer ergrimmt, "du glaubst es nicht? Ich will es dir beweisen!"
Im nächsten Augenblick huschte er als kleine, graue Maus durchs Zimmer. Aber der Kater sprang ihr nach, packte sie mit Krallen und Zähnen und fraß sie auf, und da war es für alle Zeit um den großen Zauberer geschehen.
Der Kater putzte sich nach dieser Mahlzeit noch schnurrend seinen Bart, als auch schon die königliche Kutsche in den Schlosshof rollte; denn der König hatte im Vorüberfahren an dem herrlichen Schlosse Gefallen gefunden und wünschte, es zu besichtigen. Sogleich stand auch der Kater am Wagen und bewillkommnete den Landesvater im Namen seines Herrn, des Grafen von Siebenreich. Der König war über alle Maßen erstaunt, dass dem Grafen ein so prächtiges Schloss gehörte. Diesem aber flüsterte der treue Kater in aller Eile ins Ohr, was sich zugetragen hatte und dass er wirklich der rechtmäßige Besitzer all dieser Herrlichkeiten sei. Da fiel dem guten Jungen ein Stein vom Herzen, und er führte voll ruhigen Stolzes seine hohen Gäste durch alle Räume und Gemächer.
Nun hatte der alte Zauberer gerade an diesem Tage seine Freunde bewirten wollen, und so trat man bald in einen festlich geschmückten Saal, wo auf langen Tafeln die köstlichsten Speisen und die vortrefflichsten Weine standen. Sogleich lud der junge Schlossherr den König ein, in seinem Hause zu speisen. Man nahm am Tische Platz; gewandte Diener und Dienerinnen eilten geschäftig auf und ab, und die Spielleute begannen auf einen Wink des neuen Herrn ihre Fiedeln zu streichen.
Der König aber ward immer froher, und es war ihm so behaglich zumute wie schon lange nicht mehr. Endlich aber fiel ihm etwas ein, das erschien ihm so trefflich, dass sein ganzes Gesicht zu leuchten begann. "Höre, mein lieber Graf von Siebenreich", sprach er "wie wäre es, wenn du meine Tochter zur Frau nähmest und mein Schwiegersohn und Nachfolger würdest?"
Da blickte der junge Graf die schöne Prinzessin an, und die Prinzessin blickte in herzlicher Freundlichkeit den jungen Grafen an, und sie gefielen einander so gut, dass sie sogleich mit des Königs Vorschlag einverstanden waren. Und weil man einmal so froh beisammen war, so wurde sogleich die Hochzeit gefeiert.
Der gestiefelte Kater saß an der Festtafel auf einem Ehrenplatze, und als dann der alte König des Regierens müde geworden war und dem jungen Herrn die Krone überließ, da blieb der Kater auch fernerhin im Schlosse als ein vornehmer und angesehener Edelmann und kluger Ratgeber, und der junge König und seine schöne Gemahlin hielten ihn wert bis an sein Lebensende.
Theodor Storm wurde am 14. September 1817 in Husum geboren und starb am 4. Juli 1888 in Hanerau-Hademarschen.
![]()
![]()
Es war einmal ein kleiner Junge, der hieß Häwelmann. Des Nachts schlief er in einem Rollenbett und auch des Nachmittags, wenn er müde war; wenn er aber nicht müde war, so musste seine Mutter ihn darin in der Stube umherfahren, und davon konnte er nie genug bekommen.
Nun lag der kleine Häwelmann eines Nachts in seinem Rollenbett und konnte nicht einschlafen; die Mutter aber schlief schon lange neben ihm in ihrem großen Himmelbett. "Mutter", rief der kleine Häwelmann, "ich will fahren!" Und die Mutter langte im Schlaf mit dem Arm aus dem Bett und rollte die kleine Bettstelle hin und her, und wenn ihr der Arm müde werden wollte, so rief der kleine Häwelmann: "Mehr, mehr!" und dann ging das Rollen wieder von vorne an. Endlich aber schlief sie
gänzlich ein, und so viel Häwelmann auch schreien mochte, sie hörte es nicht; es war rein vorbei.
Da dauerte es nicht lange, so sah der Mond in die Fensterscheiben, der gute, alte Mond, und was er da sah, war so possierlich, dass er sich erst mit seinem Pelzärmel über das Gesicht fuhr, um sich die Augen auszuwischen; so etwas hatte der alte Mond all sein Lebtag nicht gesehen. Da lag der kleine Häwelmann mit offenen Augen in seinem Rollenbett und hielt das eine Beinchen wie einen Mastbaum in die Höhe. Sein kleines Hemd hatte er ausgezogen und hängte es wie ein Segel an seiner kleinen Zehe auf; dann nahm er ein Hemdzipfelchen in jede Hand und fing mit beiden Backen an zu blasen. Und allmählich, leise, leise, fing es an zu rollen, über den Fußboden, dann die Wand hinauf, dann kopfüber die Decke entlang und dann die andere Wand wieder hinunter.
"Mehr, mehr!", schrie Häwelmann, als er wieder auf dem Boden war; und dann blies er wieder seine Backen auf, und dann ging es wieder kopfüber und kopfunter.
Als er dreimal die Reise gemacht hatte, guckte der Mond ihm plötzlich ins Gesicht. " Junge", sagte er, "hast du noch nicht genug?"
"Nein", schrie Häwelmann, "mehr, mehr! Mach' mir die Tür auf! Ich will durch die Stadt fahren; alle Menschen sollen mich fahren sehen!"
"Das kann ich nicht", sagte der gute Mond; aber er ließ einen langen Strahl durch das Schlüsselloch fallen, und darauf fuhr der kleine Häwelmann zum Hause hinaus.
Auf der Straße war es ganz still und einsam. Die hohen Häuser standen im hellen Mondschein und glotzten mit ihren schwarzen Fenstern recht dumm in die Stadt hinaus; aber die Menschen waren nirgends zu sehen. Es rasselte recht, als der kleine Häwelmann in seinem Rollenbett über das Straßenpflaster fuhr; und der gute Mond ging immer neben ihm und leuchtete. So fuhren sie straßenaus, straßenein; aber die Menschen waren nirgends zu sehen.
Als sie bei der Kirche vorbeikamen, da krähte auf einmal der große goldene Hahn auf dem Glockenturme. Sie hielten still.
"Was machst du da?", rief der kleine Häwelmann hinauf.
"Ich krähe zum ersten Mal!" rief der goldene Hahn herunter.
"Wo sind denn die Menschen?" rief der kleine Häwelmann hinauf.
"Die schlafen", rief der goldene Hahn herunter; "wenn ich zum dritten Mal krähe, dann wacht der erste Mensch auf!"
"Das dauert mir zu lange", sagte Häwelmann; "ich will in den Wald fahren; alle Tiere sollen mich fahren sehen!“
„Junge", sagte der gute, alte Mond, "hast du noch nicht genug?“
„Nein“, schrie Häwelmann, „mehr, mehr! Leuchte, alter Mond, leuchte!" Und damit blies er die Backen auf, und der gute, alte Mond leuchtete, und so fuhren sie zum Stadttor hinaus und übers Feld und in den dunkeln Wald hinein. Der gute Mond hatte große Mühe, zwischen den vielen Bäumen durchzukommen; mitunter war er ein ganzes Stück zurück, aber er holte den kleinen Häwelmann doch immer wieder ein.
Im Walde war es still und einsam; die Tiere waren nicht zu sehen, weder die Hirsche, noch die Hasen, auch nicht die kleinen Mäuse. So fuhren sie immer weiter, durch Tannen- und Buchenwälder, bergauf und bergab. Der gute Mond ging nebenher und leuchtete in alle Büsche; aber die Tiere waren nicht zu sehen; nur eine kleine Katze saß oben in einem Eichbaum und funkelte mit den Augen.
Da hielten sie still. "Das ist der kleine Hinze!", sagte Häwelmann. "Ich kenne ihn wohl; er will die Sterne nachmachen." Und als sie weiterfuhren, sprang die kleine Katze mit von Baum zu Baum.
"Was machst du da?" rief der kleine Häwelmann hinauf.
"Ich illuminiere!" rief die kleine Katze herunter.
"Wo sind denn die anderen Tiere?" rief der kleine Häwelmann hinauf.
"Die schlafen", rief die kleine Katze herunter und sprang wieder einen Baum weiter; "horch nur, wie sie schnarchen!"
"Junge", sagte der gute, alte Mond, "hast du noch nicht genug.
„Nein“, schrie der kleine Häwelmann, „mehr, mehr! Leuchte alter Mond, leuchte!"
Und dann blies er die Backen auf, und der gute, alte Mond leuchtete, und so fuhren sie zum Walde hinaus und dann über die Heide bis ans Ende der Welt, und dann gerade in den Himmel hinein.
Hier war es lustig; alle Sterne waren wach und hatten die Augen auf und funkelten, dass der ganze Himmel blitzte.
"Platz da!", schrie Häwelmann und fuhr in den hellen Haufen hinein, dass die Sterne links und rechts vor Angst vom Himmel fielen.
"Junge", sagte der gute, alte Mond, "hast du noch nicht genug?"
"Nein", schrie der kleine Häwelmann, "mehr, mehr!" Und - hast du nicht gesehen! fuhr er dem alten, guten Mond quer über die Nase, dass er ganz dunkelbraun im Gesicht wurde.
"Pfui!" sagte der Mond und nieste dreimal. "Alles mit Maßen!"
Und damit putzte er seine Laterne aus, und alle Sterne machten die Augen zu. Da wurde es im ganzen Himmel auf einmal so dunkel, dass man es ordentlich mit Händen greifen konnte.
"Leuchte, alter Mond, leuchte!", schrie Häwelmann; aber der Mond war nirgends zu sehen und auch die Sterne nicht; sie waren schon alle zu Bett gegangen. Da fürchtete der kleine Häwelmann sich sehr, weil er so allein im Himmel war. Er nahm seine Hemdzipfelchen in die Hände und blies die Backen auf; aber er wusste weder aus noch ein. Er fuhr kreuz und quer, hin und her, und niemand sah ihn fahren, weder die Menschen, noch die Tiere, noch auch die lieben Sterne.
Da guckte endlich unten, ganz unten am Himmelsrande ein rotes, rundes Gesicht zu ihm herauf, und der kleine Häwelmann meinte, der Mond sei wieder aufgegangen.
"Leuchte, alter Mond, leuchte!", rief er. Und dann blies er wieder die Backen auf und fuhr quer durch den ganzen Himmel und gerade drauflos. Es war aber die Sonne, die gerade aus dem Meer heraufkam. "Junge", rief sie und sah ihm mit ihren glühenden Augen ins Gesicht, "was machst du hier in meinem Himmel?"
Und eins, zwei, drei! nahm sie den kleinen Häwelmann und warf ihn mitten in das große Wasser. Da konnte er schwimmen lernen!
Und dann?
Ja, und dann? Weißt du nicht mehr? Wenn ich und du nicht gekommen wären und den kleinen Häwelmann in unser Boot genommen hätten, so hätte er doch leicht ertrinken können!
Peter Rosegger – geboren 31. Juli 1843 in Alpl in der Steiermark, gestorben 26. Juni 1918.
Österreichischer Schriftsteller, der seinen eigentlichen Namen Roßegger änderte, als seine ersten Veröffentlichungen erschienen. Es gab fünf Peter Roßegger, damit er nicht verwechselt wurde, nannte er sich Rosegger.
Der erste Christbaum in der Waldheimat
Es waren die ersten Weihnachtsferien meiner Studentenzeit. Wochenlang hatte ich schon die Tage, endlich die Stunden gezählt bis zum Morgen der Heimfahrt von Graz ins Alpl. Und als der Tag kam, da stürmte und stöberte es, dass mein Eisenbahnzug stecken blieb. Da stieg ich aus und ging zu Fuß, frisch und lustig sechs Stunden lang durch das Tal, wo der Frost mir Nase und Ohren abschnitt, dass ich sie gar nicht mehr spürte. Durch den Bergwald hinauf, wo mir so warm wurde, dass die Ohren auf einmal wieder da waren und heißer als je im Sommer.
So kam ich, als es schon dämmerte, glücklich hinauf, wo das alte Haus, schimmernd durch Gestöber und Nebel, wie ein verschwommener Fleck stand, einsam inmitten der Schneewüste. Als ich eintrat, wie war die Stube so klein und niedrig und dunkel und warm - unheimlich. In den Stadthäusern verliert man ja allen Maßstab für ein Waldbauernhaus. Aber man findet sich gleich hinein, wenn die Mutter den Ankömmling ohne alle Umständ so grüßt: "Na, weil d'nur da bist!"
Auf dem offenen Steinherd prasselte das Feuer, in der guten Stube wurde eine Kerze angezündet. "Mutter, nit!" wehrte ich ab, "tut lieber das Spanlicht anzünden, das ist schöner."
Sie tat's aber nicht. Das Kienspanlicht ist für die Werktage. Weil nach langer Abwesenheit der Sohn heimkam, war für die Mutter Feiertag geworden. Darum die festliche Kerze. Und für mich erst recht Feiertag!
Als die Augen sich an das Halblicht gewöhnt hatten, sah ich auch den Nickerl, das achtjährige Brüderlein. Es war das jüngste und letzte. "Ausschauen tust gut!" lobte die Mutter meine vom Gestöber geröteten Wangen.
Der kleien Nickerl aber sah blaß aus. "Du hast ja die Stadtfarb, statt meiner!" sagte ich und habe gelacht. Die Sache war so. Der Kleine tat husten, den halben Winter schon. Und da war eine alte Hausmagd, die sagte es - ich wusste das schon früher - täglich wenigstens dreimal, dass für ein "hustendes Leut" nichts schlechter sei als "der kalte Luft". Sie verbot es, dass der Kleine hinaus vor die Türe ging. So kam der Knabe nie ins Freie und kriegte auch in der Schule keine gute Luft zu schnappen. Ich glaube, deshalb war er so blass, und nicht des Hustens halber.
In der dem Christfest vorhergehenden Nacht schlief ich wenig - etwas Seltenes in jenen Jahren. Die Mutter hatte mir auf dem Herde ein Bett gemacht mit der Weisung, die Beine nicht zu weit auszustrecken, sonst kämen sie in die Feuergrube, wo die Kohlen glosten. Die glosenden Kohlen waren gemütlich, das knisterte in der stillfinsteren Nacht so hübsch und warf manchmal einen leichten Glutschein an die Wand, wo in einem Gestelle die buntbemalten Schüsseln lehnten. Da war ein Anliegen, über das ich schlüssig werden musste in dieser Nacht, ehe die Mutter an den Herd trat, um die Morgensuppe zu kochen. Ich hatte viel sprechen gehört davon, wie man in den Städten Weihnacht feiert. Da sollen sie ein Fichtenbäumchen, ein wirklich kleines Bäumlein aus dem Wald auf den Tisch stellen, an seinen Zweigen Kerzlein befestigen, sie anzünden, darunter sogar Geschenke für die Kinder hinlegen und sagen, das Christkind hätte es gebracht.
Nun hatte ich vor, meinem kleinen Bruder, dem Nickerl, einen Christbaum zu errichten. Aber alles im Geheimen, das gehörte dazu. Nachdem es soweit taglicht geworden war, ging ich den frostigen Nebel hinaus. Und just dieser Nebel schützte mich vor den Blicken der ums Haus herum arbeitenden Leuten, als ich vom Walde her mit meinem Fichtenwipfelchen gegen die Wagenhütte lief, dort das Bäumchen in ein Scheit bohrte und unter dem Karren- und Räderwerk versteckte.
Dann war es Abend. Die Gesindeleute waren noch in den Ställen beschäftigt oder in den Kammern, wo sie sich nach der Sitte des Heiligen Abends die Köpfe wuschen und ihr Festgewand herrichteten. Die Mutter in der Küche buk die Christtagskrapfen und der Vater mit dem kleinen Nickerl besegnete den Hof. Da hatte nämlich der Vater in einem Gefäß glühende Kohlen, hatte auf dieselben Weihrauch gestreut und ging damit durch alle Räume des Hofes, durch die Stallungen, Scheunen und Vorratskammern, in alle Stuben und Kammern des Hauses endlich, um sie zu beräuchern und dabei schweigend zu beten. Es sollten böse Geister vertrieben und gute ins Haus gesegnet werden.
Dieweilen also die Leute draußen zu tun hatten, bereitete ich in der großen Stube den Christbaum. Das Bäumchen, das im Scheite stak, stellte ich auf den Tisch. Dann schnitt ich vom Wachsstock zehn oder zwölf Kerzchen und klebte sie an die Ästlein. Unterhalb, am Fuße des Bäumchens, legte ich den Wecken hin.
Da hörte ich über der Stube auf dem Dachboden auch schon Tritte - langsame und trippelnde. Sie waren schon da und segneten den Bodenraum. Bald würden sie in der Stube sein, mit der wir den Rauchgang zu beschließen pflegten. Ich zündete die Kerzen an und versteckte mich hinter den Ofen. Noch war es still. Ich betrachtete vom Versteck aus das lichte Wunder, wie in dieser Stube nie ein ähnliches gesehen worden. Die Lichtlein auf dem Baum brannten so still und feierlich - als schwiegen sie mir himmlische Geheimnisse zu.
Endlich hörte ich an der Schwelle des Vaters Schuhklöckeln. Die Tür ging auf, sie traten herein mit ihren Weihgefäßen und standen still.
"Was ist den das?" sagte der Vater mit leiser langgezogener Stimme. Der Kleine starrte sprachlos drein. In seinen großen, runden Augen spiegelten sich wie Sternlein die Christbaumlichter. - Der Vater schritt langsam zur Küchentür und flüsterte hinaus: "Mutter! - Mutter! Komm ein wenig herein" Und als sie da war: "Mutter, hast du das gemacht?" "Maria und Josef!" hauchte die Mutter. "Was lauter habens denn da auf den Tisch getan?" Bald kamen auch die Knechte und Mägde herbei, hell erschrocken über die seltsame Erscheinung. Da vermutet einer, ein Junge, der aus dem Tal war: Es könnt ein Christbaum sein . .
Sollte es denn wirklich wahr sein, dass Engel solche Bäumlein vom Himmel bringen? - Sie schauten und staunten. Und aus des Vaters Gefäß qualmte der Weihrauch und erfüllte schon die ganze Stube, so dass es war wie ein zarter Schleier, der sich über das kerzenbrennende Bäumchen legte.
Die Mutter suchte mit den Augen in der Stube herum: "Wo ist den der Peter?"
Da erachtete ich es an der Zeit, aus dem Ofenwinkel hervorzutreten. Den kleinen Nickerl, der immer noch sprachlos und unbeweglich war, nahm ich an den kühlen Händchen und führte ihn vor den Tisch. Fast sträubte er sich. Aber ich sagte - selber tief feierlich gestimmt - zu ihm: "Tue dich nicht fürchten, Brüderl! Schau, das lieb' Christkindl hat dir einen Christbaum gebracht. Der ist dein."
Und da hub der Kleine an zu wiehern vor Freude und Rührung, und die Hände hielt er gefaltet wie in der Kirche. - - -
Öfter als vierzigmal seither habe ich den Christbaum erlebt, mit mächtigem Glanz, mit reichen Gaben und freudigem Jubel unter Großen und Kleinen. Aber größere Christbaum-freude, ja eine so helle Freude habe ich noch nie gesehen, als jene meines kleinen Brüderleins Nickerl - dem es so plötzlich und wundersam vor Augen trat - ein Zeichen dessen, der da vom Himmel kam.
Der alte Naz war auf einem Ohr schwerhörig. Sein rechtes Ohr hatte die wunderliche Gabe, die Tiersprachen zu verstehen, die von anderen Leuten nur für Bellen oder Blöken oder Zwitschern gehalten wurde. „Wenn die Menschen wüssten, was der Zugochs oder der Kettenhund oder andere über sie redeten! Zum Herzabdrücken wär’s!“, sagte er.
Eines Tages führten mehrere Knaben den Naz hinab zu den Eschen am Bach. Dort hatten sie Häuschen aufgestellt um Vögel zu fangen und der Naz sollte auch mittun. In einem der Häuschen hatte sich ein Vogel gefangen und flatterte ängstlich zwitschernd hin und her.
Der Natz klettert auf den Stamm. „Muss doch wissen, warum du gar so lustig bist“, sagte er und hielt sein rechtes Ohr an das Häuschen. Mit dem Zeigefinger winkte er: Pst! Sie sollten ruhig sein. Und tat, als horche er dem Tiere.
„Das ist jetzt eine schöne Geschichte!“, sagte er. „Dem Vogel ist`s nicht recht da drinnen.“ Dann horchte er wieder. – „Armer Kerl!“, rief er endlich und sagte zu den Knaben gewendet: „Er klagt und weint, dass sich ein Stein erbarmen kunnt. Sein Weibchen, sagt er, sitzt im Nest bei den Jungen. Er sollte Körner und Käfer suchen und seine lieben Leute speisen. Und jetzt sei er in dieses Unglück geraten. Die seinen müssten verhungern und verderben.“
„Auslassen!“, schrie einer der Knaben. „Siehst du!“, rief Naz gegen den Vogel gewendet; „siehst du, wie du Glück hast! Sie wollen dich auslassen. Sind ja lauter brave Jungen, die ein Herz im Leib haben für ein armes, liebes Vögerl!“
„Auslassen, auslassen!“, schrien jetzt alle. Der Naz hob den Deckel und der Vogel flog wie ein Pfeil in die Luft. – So trieb’s der Naz.
zum Seitenanfang zurück zur Hauptseite